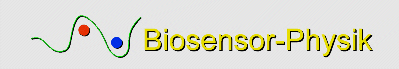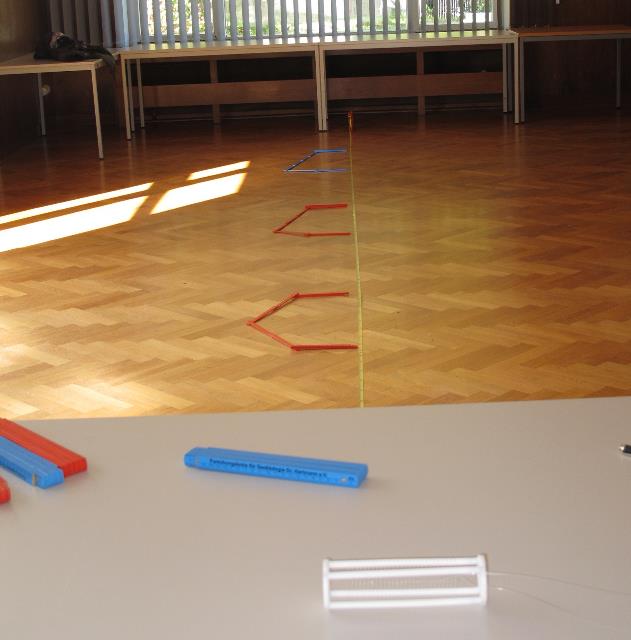Beobachtungen:
Bewegte-materie-oszillierend-zwei
Fortsetzung von bewegte-materie-oszillierend.htm
12. Rotierende Objekte
12.1 ohne zusätzliches Magnetfeld
12.2 Rotation innerhalb von einem Magnetfeld
13. frühere Experimente
13.1 Wasser im Gefäß wird gerührt
13.2 Wasser, Druckluft und Licht fließt in einem Viertelkreis, Bogen, Spule
13.2.1 Strömung in einem geraden Abschnitt
13.2.2 Strömung in einem gebogenen Abschnitt
13.2.3 Spule, mehrere Kreise in Reihe
13.2.3a rotierendes elektrisches Feld
13.2.3b rotierendes magnetisches Feld
13.2.4 Dipol, Periodische Strömung
13.2.5 Viertelkreis
13.3 rotierende Objekte, Magnet, geladene Kugel, Rohre, Glaskugel, Lehmkugel
transversal, periodisch hin und her noch an der richtigen Stelle einfügen 4.3.25
wsiehe auch VIDEO dscn8456.MOV ff
06-02-2017
 |
 |
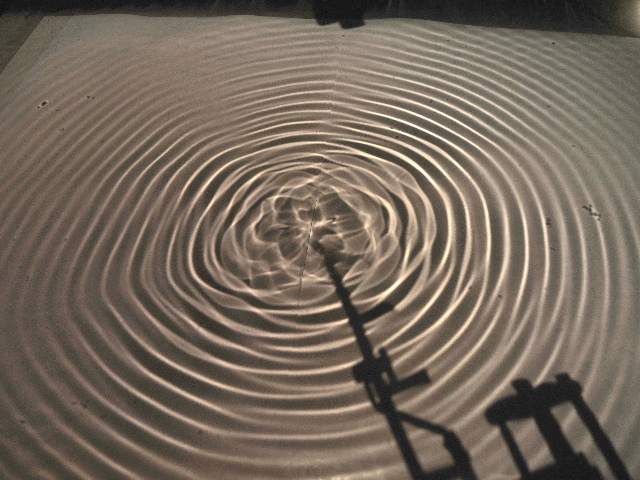 |
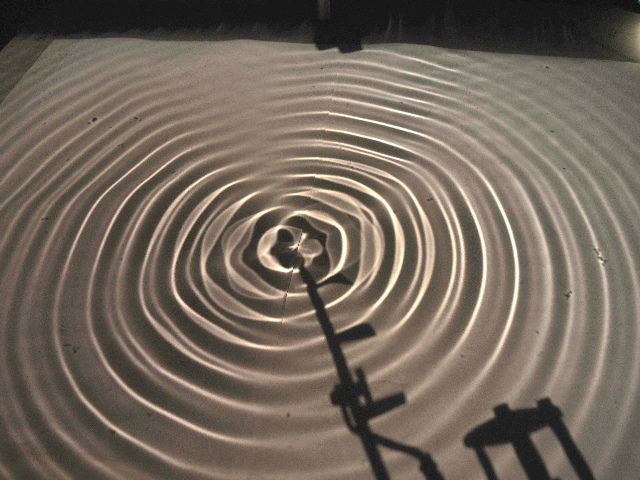 |
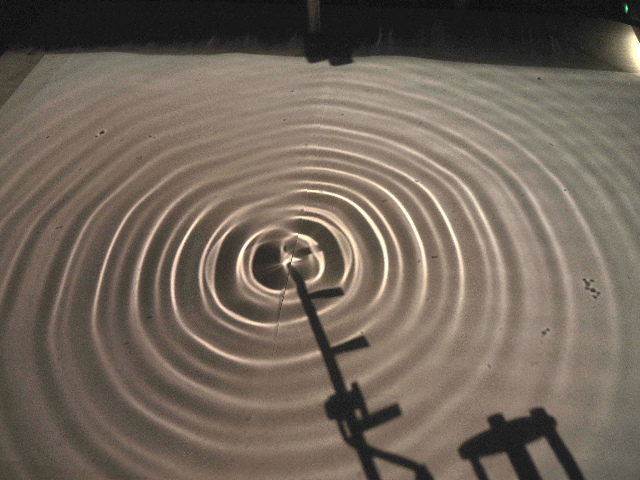 |
12 . Rotierende Objekte
| amorphe Materialien: | aktive Elemente:
|
| nur schwache
zusätzliche Strukturen bei Rotation, sie wachsen mit der Drehzahl an, Drehrichtung beeinflußt, ob Strukturen auf der Ober- oder der Unterseite anwachsen |
Struktur bei Rotation,
vergrößert sich mit der Drehzahl |
| rotierender Gipszylinder, Abb.
12-01-07: rotierende Lehmkugel, Abb. 13-03-05: |
11.09.2019
 |
Abb. 12-01-01: Ein rotierender
Körper wird über einen Zahnriemen angetrieben.aus licht-experimente.htm#kapitel-05-04 |
31.07.2019
 |
| Abb. 12-01-02: Links der Antrieb,
rechts der Drehteller mit dem Porbekörper (FB) |
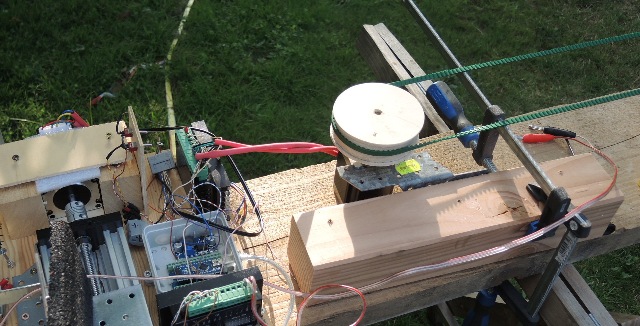 |
| Abb. 12-01-03:Der Antrieb:
Schrittmotor rechts mit Holzrad, links die
Elektronik zur Ansteuerung. (FB) bewegte-materie-oszillierend.htm#kapitel-10-02 und bewegte-materie-oszillierend.htm#kapitel-09-03 (FB) |
 |
| Abb. 12-01-04: Antrieb des
Zahnriemens mit einer hölzernen Scheibe (FB) |
 |
| Abb. 12-01-05: Die beiden Holzlatten
sollen das Durchhängen der Zahnriemen vermindern
(FB) |
 |
| Abb. 12-01-06: Probekörper: Ein Glas
Bier (FB) |
 |
| Abb. 12-01-07: 03.08.2019 ein
Zylinder aus Gips. 687g, Er hat keine
starken inneren Strukturen wie aktive-Elemente
z.B. Zieh- oder Wachstumsrichtung, aber schwache
Strukturen (Orbital...) Diese verändern sich durch die Rotation, je nach Drehrichtung. mal auf der Oberseite, mal auf de Unterseite. Auch keine Änderung bei einem zusätzlichen Magnetfeld mit 50 nA in einer Helmholtzspule. (FB) |
 |
| Abb. 12-01-08: Kegel aus Aluminium
(FB) |
 |
| Abb. 12-01-09: Zylinder aus Kupfer
(FB) |
 |
| Abb. 12-01-10: Hohlkugel aus
verzinktem Blech, Zaunpfahlkappe (FB) |
 |
Abb. 12-01-11: konischer Körper aus
Wismut konische-koerper.htm#kapitel-04-02 |
 |
| Abb. 12-01-12: konischer Körper aus
Zinn (FB) |
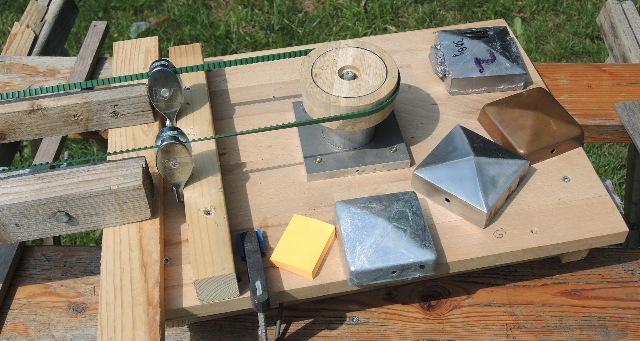 |
| Abb. 12-01-13: konische Körper,
Zaunpfahlkappen (FB) |
 |
| Abb. 12-01-14: 15.02.2025
Gipskörper, Synchromotor mit verstellbarem Getriebe, Stellung "0,3" entspricht 0,3 Umdrehungen pro Minute, d.h. drei Minuten für eine Umdrehung. Im Stillstand gibt es vier "Keulen" im Winkel von 90°, Radius 0,5 m, einen Kelch wie bei einer Tulpe und eine Keule in Achsenrichtung Bei CCW (von oben) wachsen sie an auf 1,9 m, bei CW schrumpfen sie auf 0,2 m (FB) |
 |
| Abb. 12-01-15: Blick von oben, auf
die vier Markierungen mit Kugelschreiber (fB) |
 |
| Abb. 12-01-16: 16.02.2025
Lehmkugel 611g, sechs Keulen senkrecht zur Achse, bei Stillstand 0,15 m, bei CCW Rotation (von oben) 1,8 m, bei CW 0,2 m (FB) |
 |
| Abb. 12-01-17: 16.02.2025
Lehmkugel 611g, sechs Elemente (FB) |
 |
| Abb. 12-01-18: Kiefernzapfen,
ist ein aktiver Körper, bei CCW Rotation und
CW Rotation, hat große intensive Strukturen bei 0,03 Umdrehungen pro Minute : Strukturen dehnen sich aus, bzw. ziehen sich zusammen aus wasser-ader-drei-02.htm Abb. 06-11-00-21h (FB) |
12.2 Rotation innerhalb von einem Magnetfeld
 |
Abb. 12-02-01: 05.08.2019 Es
rotiert eine Linse aus Aluminium in einer
Helmholtzspule
helmholtz-spule.htm
konische-koerper.htm#kapitel-04-02(FB) |
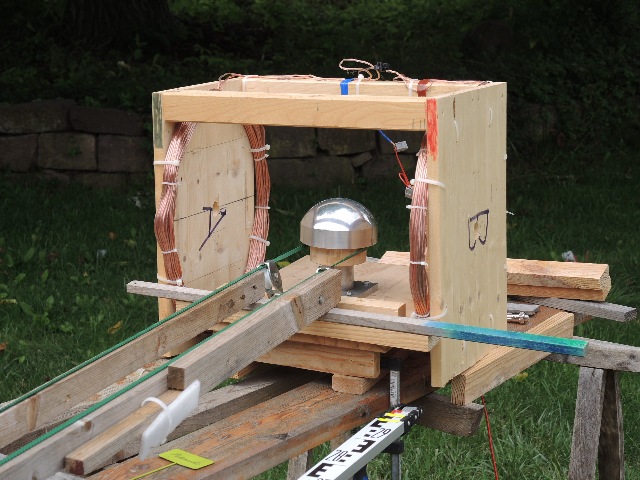 |
| Abb. 12-02-02: Die Linse
Aluminium 1495 g rotiert in der Helmholtzspule, Linse: licht-experimente.htm#kapitel-03 Magnetfeldachse horizontal, Material der Spule: Kabel für Lautsprecherzuleitungen Gleichstrom +9.5 nA, Strukturen entstehen beim Abbremsen und Beschleunigen, (Beobachtungen oberhalb der Äquatorebene) bei CCW bremsen: schwach, beschleunigen stark bei CW bremsen: stark, beschleunigen schwach ? bei umgepolten Strom umgekehrt? noch Forschungsbedarf 06.08.2019 (FB) |
 |
| Abb. 12-2-03: eine Scheibe aus
Aluminum 1161 g rotiert in der Helmholtzspule
Magnetfeldachse vertikal 06.08.2019 wenn Beschriftung unten: 50 nA, bei Polung 1 starke Struktur, bei Polung 2 schwache Struktur Beschriftung oben: 50 nA bei Polung 1 schwach, bei Polung 2 stark Der aktive Körper erzeugt Strukturen beim Beschleunigen und Abbremsen. Mit dem Magnetfeld in Achsenrichtung lassen sich die Qualitäten der Strukturen schwach/stark beeinflussen. Einfluß der Richtungen von Magnetfeld und vom aktiven körper verhalten sich komplementär. (FB) |
 |
| Abb. 12-02-04: Helmholtzspule mit
Kupferdraht, der mit Seide umsponnen ist. helmholtz-spule.htm Darinnen rotiert ein Zylinder aus Eisen. Es gibt stark spürbare Strukturen z.B. bei 50 nA undeiner Art der Polung ("blau = rot") bewegte-materie-oszillierend.htm#kapitel-08-046.8.2019 mit der geeigneten Polung läßt sich die Qualität der Struktur verändern. Wenn der Zylinder dauernd rotiert, wächst der Radius einer ringförmigen Struktur ständig an. Bei der Geschwindigkeit "2000" schneller als bei "1000". (FB) |
 |
| Abb. 12-02-05: 08.08.2019 Helmholtz-Spule ohne Drehteller, ohne Eisenzylinder Es gibt um die Spule herum konzentrische Strukturen, die bei Stromfluß mit der Zeit anwachsen. Sie haben Phantom-Eigenschaft, d. h. sie bleiben nach Abschalten des Stromes erhalten, lassen sich jedoch mit lautem Händeklatschen sofort beseitigen. Gemessen wurde die Ausdehnung mit einem Maßband (rechts unten im Bild) in Richtung Nord-Ost. 09.08.2019 phantom.htm (FB) |
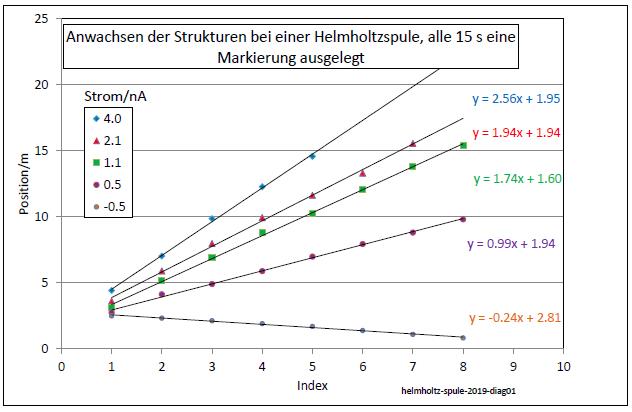 |
| Abb. 12-02-06: Die Strukturen wachsen
mit der Zeit an. Alle 15 Sekunden wurde eine
Markierung ausgelegt: Meßrichtung Nord-Ost (FB) |
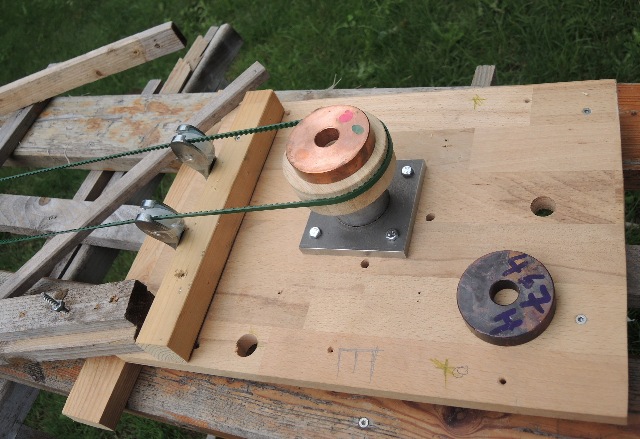 |
| Abb. 12-02-07: 11.08.2019 Der Kupferzylinder mit Innenloch ist ein "aktiver Körper", rechts das ausgeglühte Kupferstück ist es nicht. Beim "aktiven Körper" ist Beschleunigung und Abbremsen gut zu spüren. 12.08.2019 (FB) |
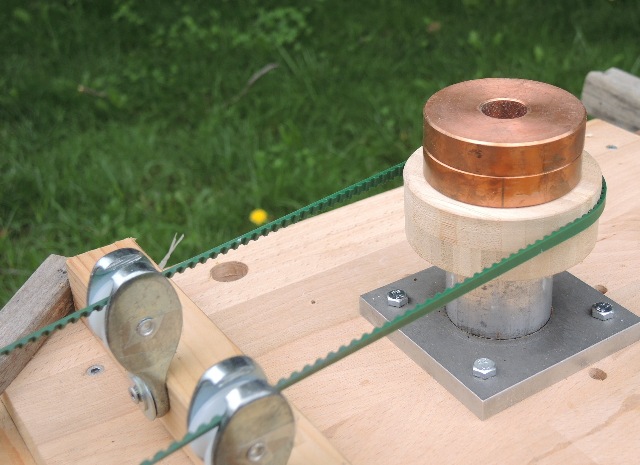 |
| Abb. 12-02-08: zwei Kupferscheiben
aufeinander mit gemeinsamer/ entgegengesetzter
Ziehrichtung Bei entgegengesetzter Ausrichtung heben sich die Wirkungen der spürbaren Zonen beider Scheiben auf (Kompensierung). Bei übereinstimmender Ziehrichtung bleibt die Eigenschaft "aktiver Körper", im anderen Fall hebt sie sich auf. Beschleunigung bzw. Abbremsen ist nur bei übereinstimmender Ziehrichtung gut zu spüren. (FB) |
 |
| Abb. 12-02-09: Auf die Ziehrichtung
kommt es an. zwei Scheiben aus Kupfer je 468 g der rote Punkt markiert die Ziehrichtung. (FB) |
| Das Magnetfeld ließ sich per
Fernbedienung ein/ausschalten. Versuch2: Eine ausgeglühte Scheibe rotiert, 467g, hat keine spürbaren Strukturen Versuch3: axiales Magnetfeld, 2 nA, zwei Scheiben übereinander, Magnetfeld ein/aus, gut spürbar. Versuch4: DECT neben die rotierenden Kupferscheiben => starkt spürbar "infiziert" Versuch5: 6 Scheiben übereinander, nicht rotierend, 2 nA Magnetfeld ein/aus, gut spürbar Versuch6: rotierend gut spürbar Versuch7: Alu-Linse rotierend, Magnetfeld ein/aus , bei +2nA schwach bei -2nA stärker spürbar (andere Qualität?) (FB) |
13. frühere Experimente
13.1 Wasser im Gefäß wird gerührt
 |
Abb. 13-01-01: Holzstab, exzentrisch,
rührt Wasser in einer Schale, 08.09.2010aus kuehlwasser-vier-03.htm |
 |
Abb. 13-01-02: 08.09.2010
Strukturen vom gerührten Wasser in der Schale.aus kuehlwasser-vier-03.htm |
 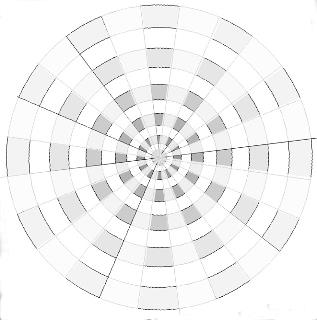 |
Abb. 13-01-03: ähnlich wie eine
"Senderstruktur"aus kuehlwasser-vier-03.htm |
 |
Abb. 13-01-04: 13.09.2010aus kuehlwasser-vier-03.htm |
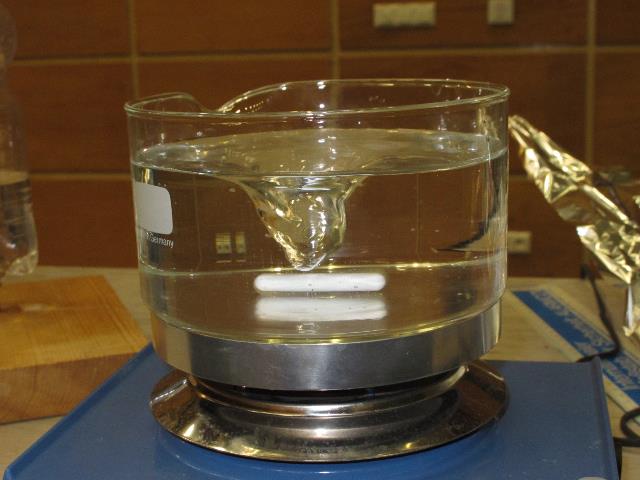 |
| Abb. 13-01-05: 13.09.2010,
Wasser und Eisenstäbchen rotieren in einer
Schale, Das Eisenstäbchen wird von einem rotierenden Magnet unter der Heizplatte angetrieben. aus kuehlwasser-vier-03.htm |
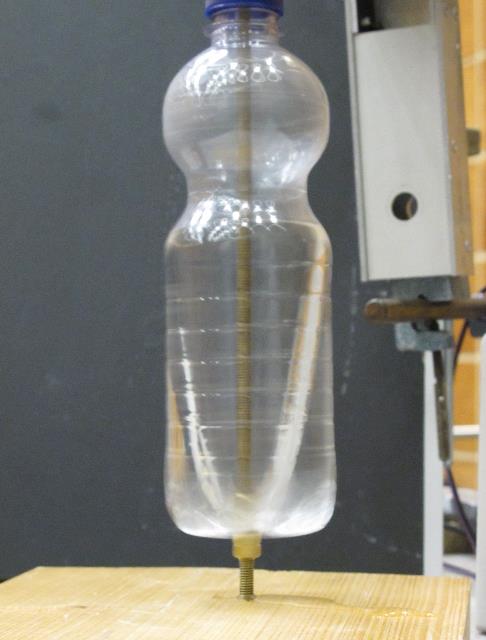 |
Abb. 13-01-06: Wasserflasche auf
einer Messing-Gewindestange befestigt. Oben ist ein
Motor, der die Stange antreibt.aus kuehlwasser-vier-03.htm |
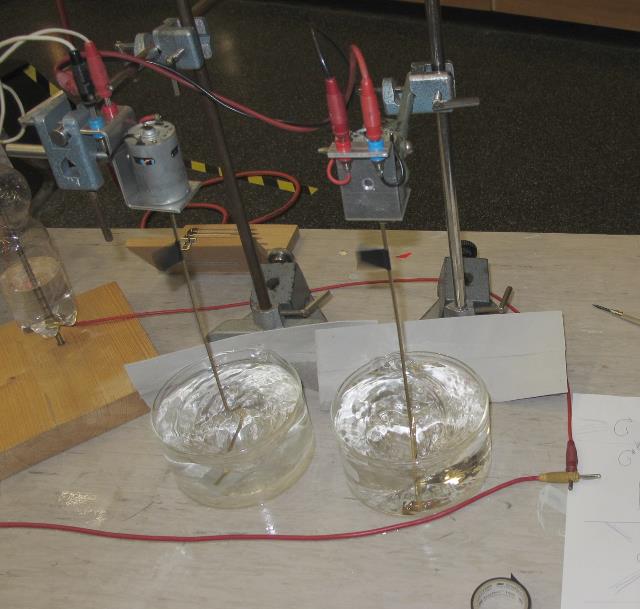 |
Abb. 13-01-07: 14.09.2010
Rühren mit entgegengesetzter Richtungaus kuehlwasser-vier-03.htm |
 |
| Abb. 13-01-08: Stukturen bei den
beiden Wassertöpfen mit einstellbarer Drehrichtung. a) CW und CCW Ost-West b) CW und CW Nord-Süd c) CCW und CCW Diagonalen und Süd d) CCW und CW Nord, NO, Ost, SO aus kuehlwasser-vier-03.htm |
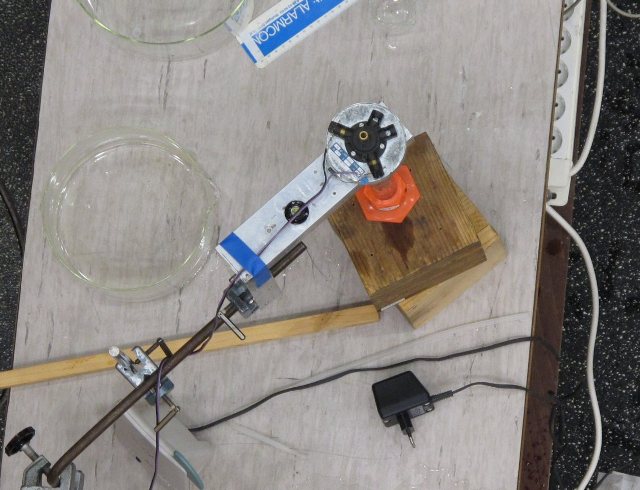 |
| Abb. 13-01-09: Am unteren Ende der
Achse des Motors ist ein Glasstab-Rührer befestigt.
(FB) |
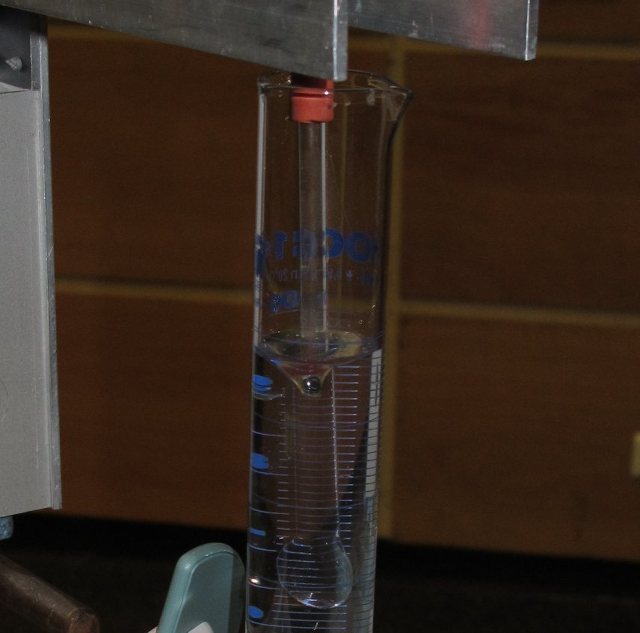 |
| Abb. 13-01-10: Das Wasser
im Meßzylinder wird mit dem Glasstab gerührt. (FB) |
 |
Abb. 13-01-11: 09.09.2010
helblau: Drehrichtung CCW, gelb: CW,
regelmäßige Anordnung von radialen Strukturelementenaus kuehlwasser-vier-03.htm |
Kochtopf mit Wasser, mit der Hand gerührt
 |
| Abb. 13-01-12: 08.09.2010 genutzt für die nächsten Daten wurde der mittlere Edelstahltopf, gerührt wurde mit dem Holzlöffel. aus kuehlwasser-vier-03.htm |
 |
Abb. 13-01-13: 08.09.2010,
Blick nach Südenaus kuehlwasser-vier-03.htm |
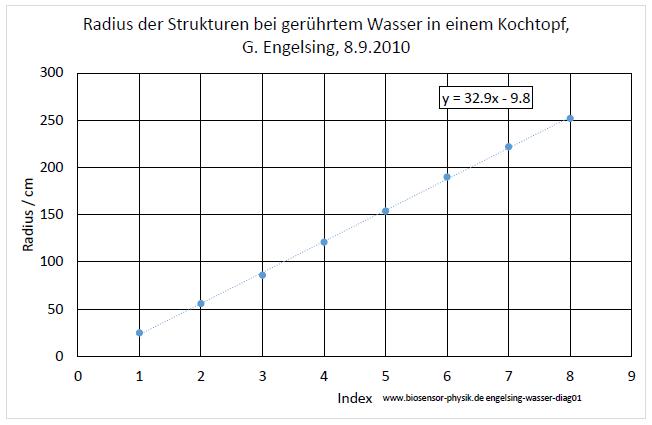 |
| Abb. 13-01-14: mittlerer Abstand der
Strukturelemente: 32.9 cm (FB) |
13.2 Wasser, Druckluft und Licht fließt in einem Viertelkreis, Bogen, Spule
13.2.1 Strömung in einem geraden Abschnitt
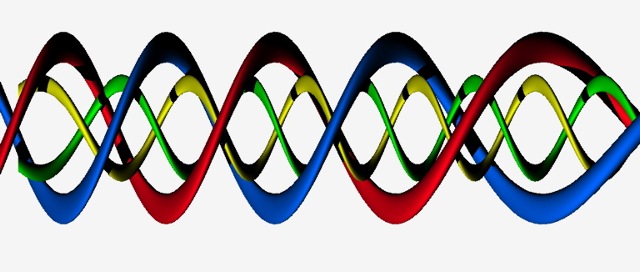 |
Abb. 13-02-01-01: schematisch:
Doppelschrauben um die Achse der Strömungaus wasser-ader-zwei.htm#kapitel-08 |
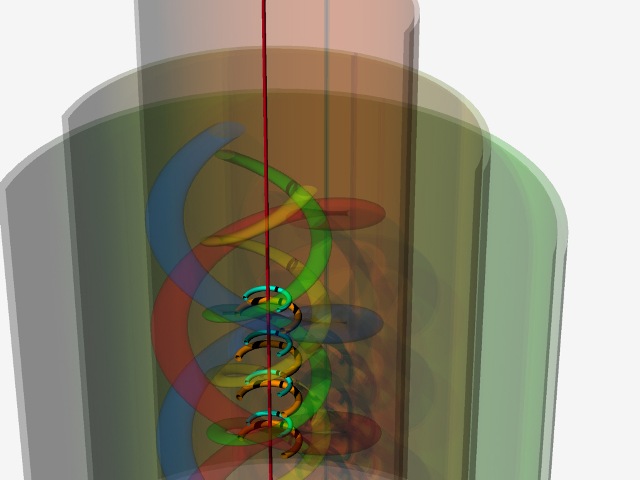 |
Abb. 13-02-01-02: schematisch: neben
den Doppelschrauben gibt es weitere Elemente im
Außenraumaus wasser-ader-zwei.htm#kapitel-09-01 |
13.2.2 Strömung in einem gebogenen Abschnitt
 |
Abb. 13-02-02-01: Strömung um
einen Viertelkreis 4.10.2013aus kuehlwasser-zwanzig-zwei.htm#kapitel-11 |
 |
| Abb. 13-02-02-02:
Kupferkapillare und Lichtleiter aus Kunststoff
(FB) |
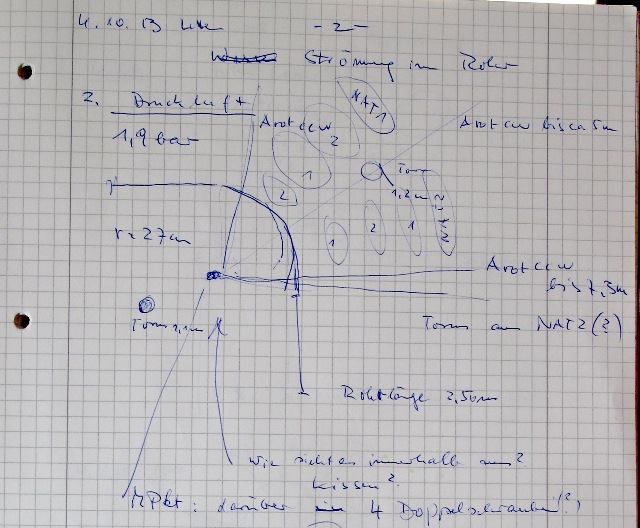 |
| Abb. 13-02-02-03: Druckluft fließt
durch einen Kupferrohrbogen. Im Außenraum gibt es ein reguläres Muster von Zonen mit abwechselnden Qualtiäten. aus kuehlwasser-zwanzig-zwei.htm#kapitel-11 |
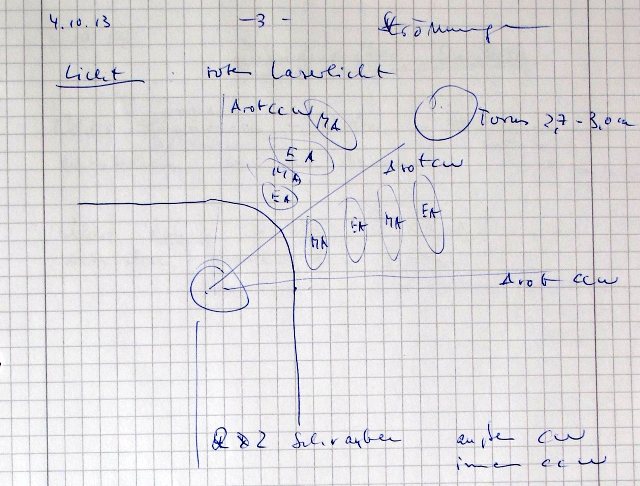 |
Abb. 13-02-02-04: Licht geht durch
einen Lichtleiteraus kuehlwasser-zwanzig-zwei.htm#kapitel-11 |
 |
Abb. 13-02-02-04: Wasser
strömt im Schlauch, in einem Viertelkreis, 08.07.2018aus wasser-ader-zwei.htm#kapitel-05 |
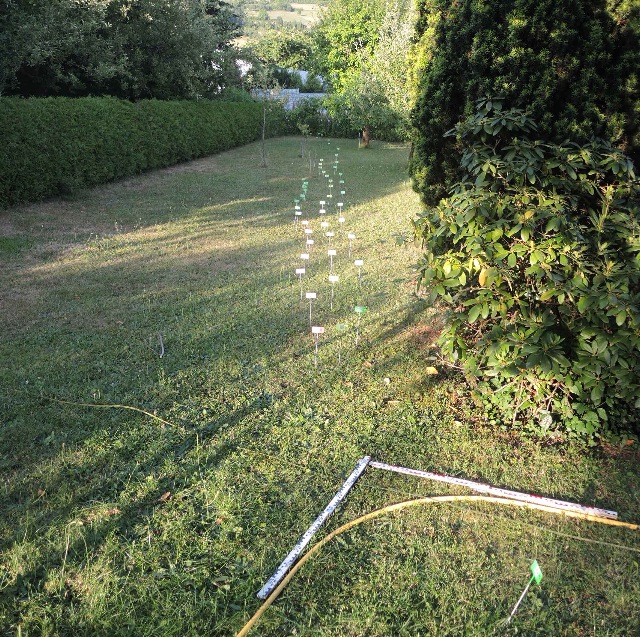 |
Abb. 13-02-02-05: 02.08.2018
Markierung der Wirbelzellen mit Reflektormarken
für die Vermessungaus wasser-ader-zwei.htm#kapitel-05 |
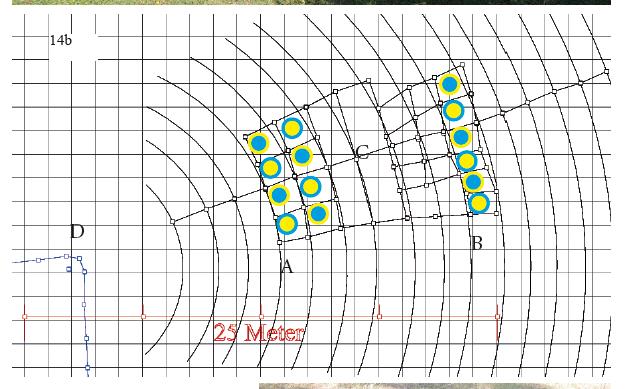 |
| Abb. 13-02-02-06: Vermessung der
gefundenen Strukturen beim Schlauchbogen D Wirbelzellen im Außenraum des Bogens, maßstäbliche Darstellung, Raster: 1 m x 1 m aus wasser-ader-zwei.htm#kapitel-05 |
13.2.3 Spule, mehrere Kreise in Reihe
Spulenachse horizontal
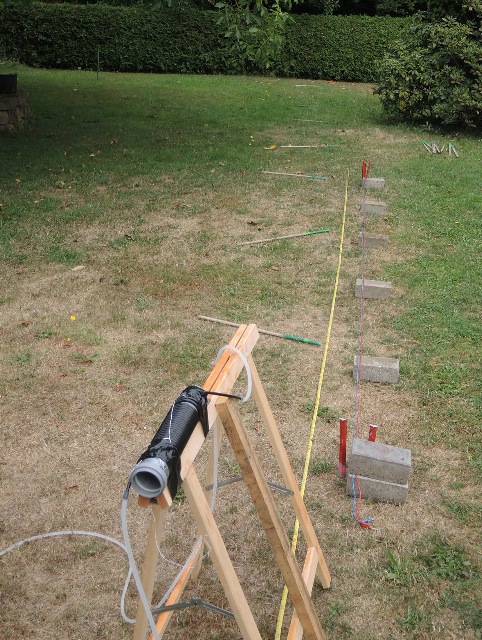 |
Abb. 13-02-03-01:
aus wasser-ader-zwei.htm#kapitel-07 |
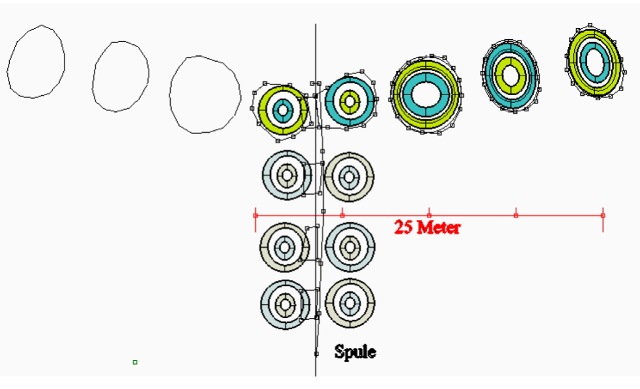 |
Abb. 13-02-03-02:
aus wasser-ader-zwei.htm#kapitel-07 |
 |
Abb. 13-02-03-03:
aus wasser-ader-zwei.htm#kapitel-07 |
Spulenachse vertikal
 |
Abb. 13-02-03-04:
aus wasser-ader-zwei.htm#kapitel-07 |
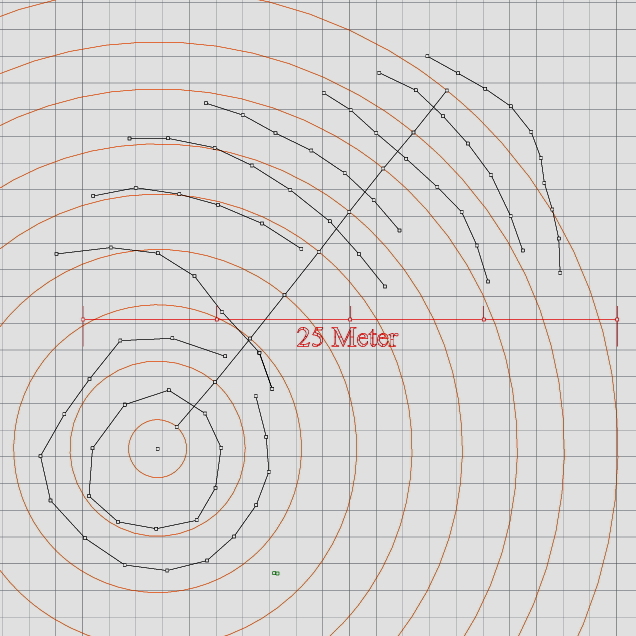 |
Abb. 13-02-03-05:
aus wasser-ader-zwei.htm#kapitel-07 |
Spulenachse horizontal
 |
Abb. 13-02-03-06:
aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-01 |
 |
Abb. 13-02-03-07:
aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-01 |
 |
Abb. 13-02-03-08: Elektrischer Strom
in einer Spule erzeugt ein Magnetfeld
|
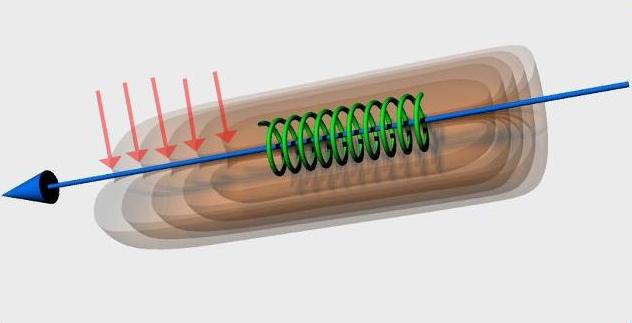 |
Abb. 13-02-03-09: feinstoffliche
Strukturen um eine Strömung in einer Spuleaus stab-und-spirale.htm#kapitel-05-06 |
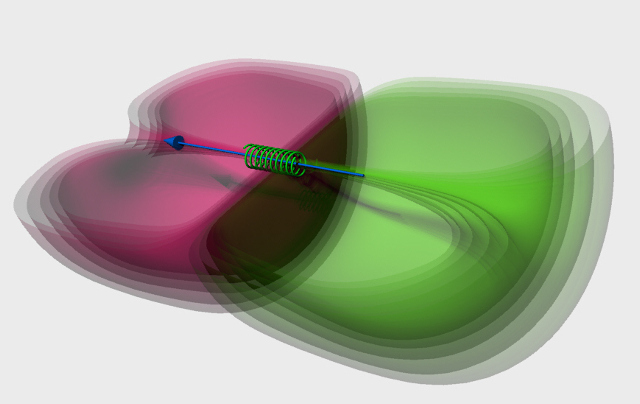 |
| Abb. 13-02-03-08:
feinstoffliche Strukturen um eine Strömung in einer
Spule Die Qualitäten an beiden Enden unterschiedliche sich. siehe Fischgräten: toroidspule-test.htm wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-03 physik-neu-006.htm
|
 |
Abb. 13-02-03-09: aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-01 |
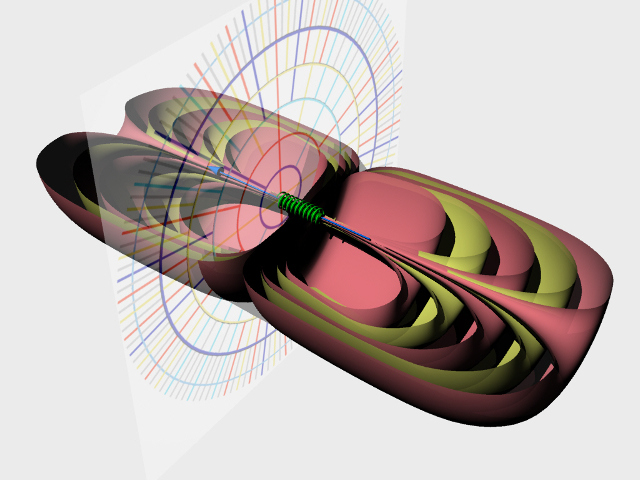 |
| Abb. 13-02-03-10: |
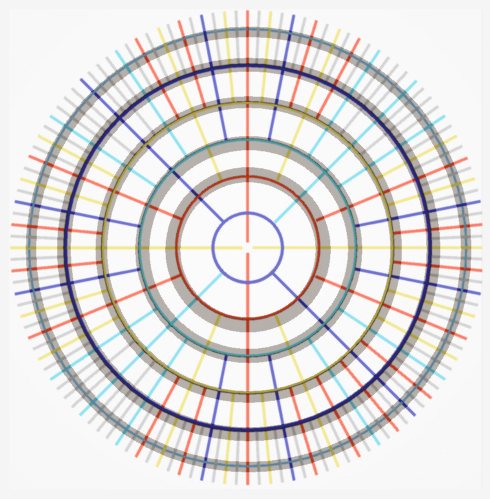 |
Abb. 13-02-03-11:
aus stab-und-spirale.htm#kapitel-05-06 |
Spule aus einem Lichtleiter
 |
Abb. 13-02-03-12: Glasfaser auf einen
Träger gewickelt.aus stab-und-spirale.htm#kapitel-01-00 |
|
|
Abb. 13-02-03-13: vorne die Glasfaser
auf dem Träger aus stab-und-spirale.htm#kapitel-01-00 |
Spule aus einem dünnen Wasserschlauch um eine Edelgasampulle
 |
Abb. 13-02-03-14: roter
Schrumpfschlauch als Spule gewickelt. von rechts
kommt Wasser aus einem Drucktank. In der Spule steht
eine Glasampulle, die mit Xenon gefüllt ist.aus kuehlwasser-zwanzig-zwei.htm#kapitel-08 |
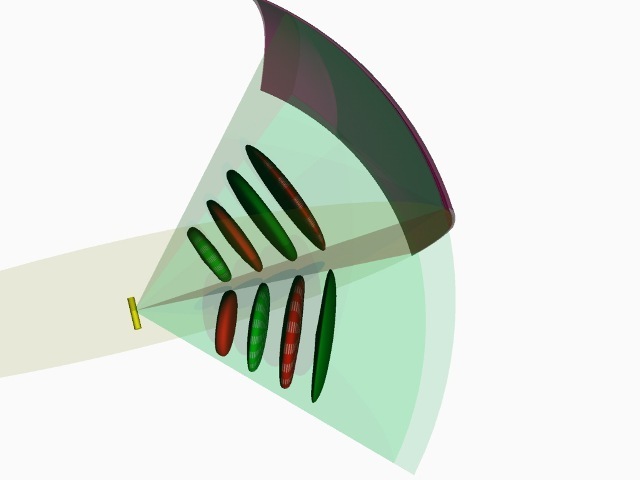 |
Abb. 13-02-03-15: Elemente der
Struktur, schematisch, die Ampulle ist dort, wo der
kleine gelbe Zylinder liegt.aus edelgas-ampullen.htm |
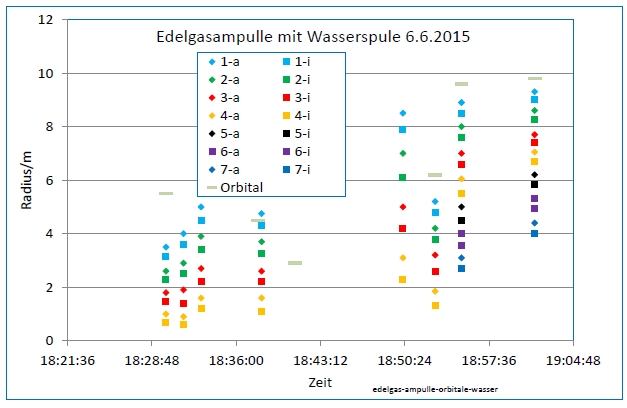 |
Abb. 13-02-03-16: Die Strukturen
dehnen sich mit der Zeit aus, wenn Wasser durch die
Spule fließt.aus kuehlwasser-zwanzig-zwei.htm#kapitel-08 |
13.2.3a rotierendes elektrisches Feld
 |
Abb. 13-02-03a-01:aus quadrupol-kondensator.htm#kapitel-02 |
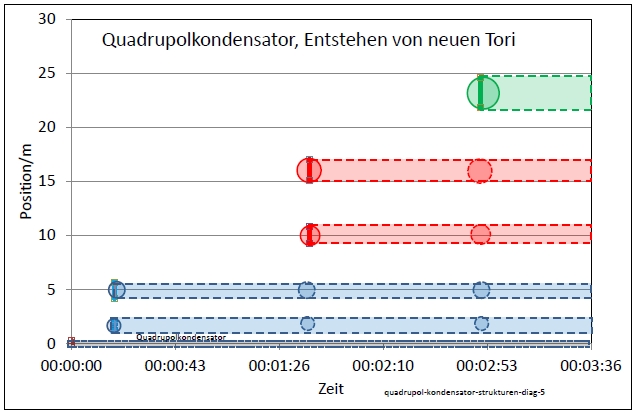 |
Abb. 13-02-03a-02:aus quadrupol-kondensator.htm#kapitel-02 |
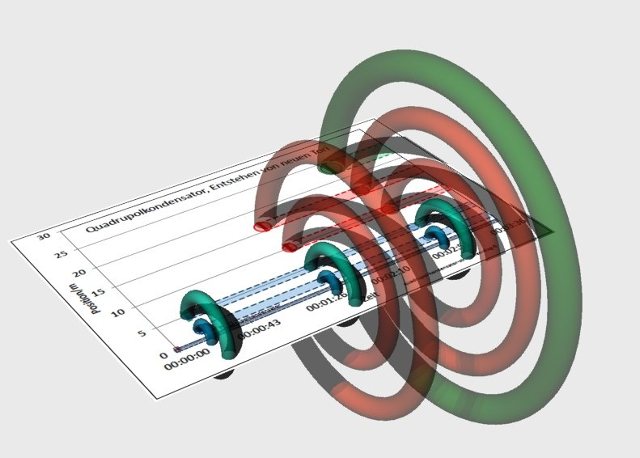 |
Abb. 13-02-03a-03:aus quadrupol-kondensator.htm#kapitel-02 |
13.2.3b rotierendes magnetisches Feld
rotierende-magnetfelder.htm
 |
aus rotierende-magnetfelder.htm#kapitel-02 |
| Magnet auf Besenstil |
13.2.4 Dipol, Periodische Strömung
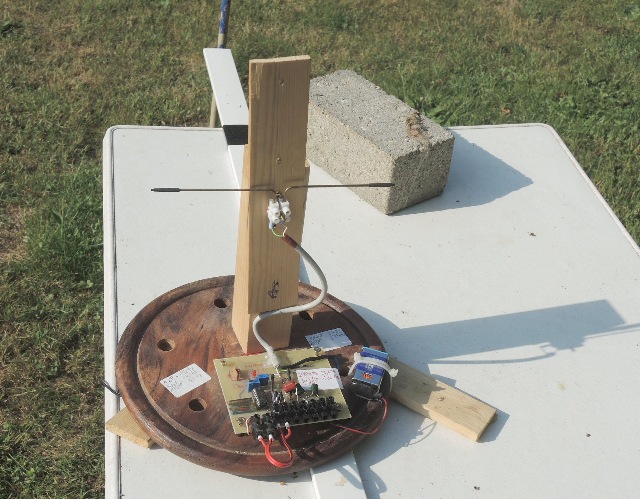 |
Abb. 13-02-04-01:
aus dipol.htm#kapitel-01 |
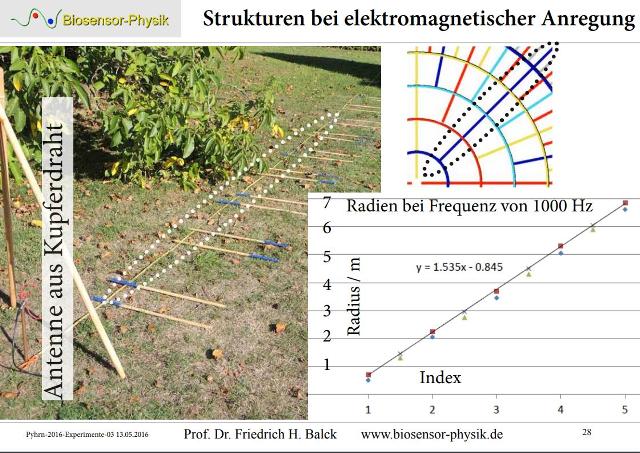 |
Abb. 13-02-04-02: Strukturen bei
einem Stabdipol bei Wechselspannung von 1000 Hzaus pyhrn-2016-experimente-02.pdf |
13.2.5 Viertelkreis
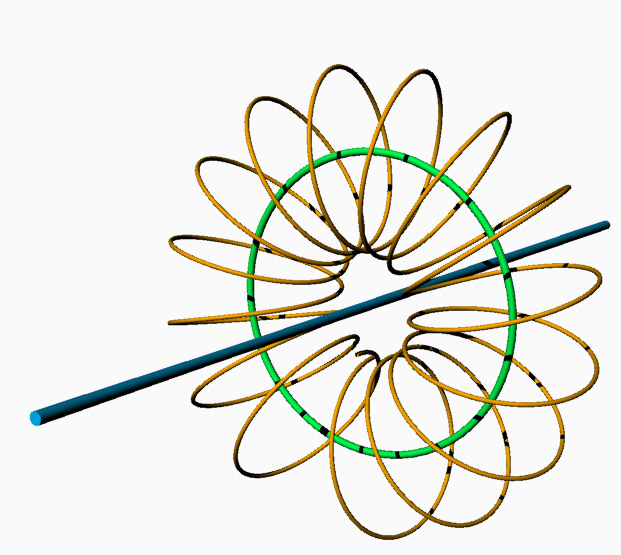 |
| Abb. 13-02-05-01:Strukturen um einen
einzelnen gerader Leiter Wie bei der Verkettung von elektrischem Strom (blau) und magnetischem Fluß (grün) sowie dem Vektorpotential (ocker) aus maxwell-drei.htm#kapitel-03 aus fliess-richtung-01.htm#kapitel-02-02 |
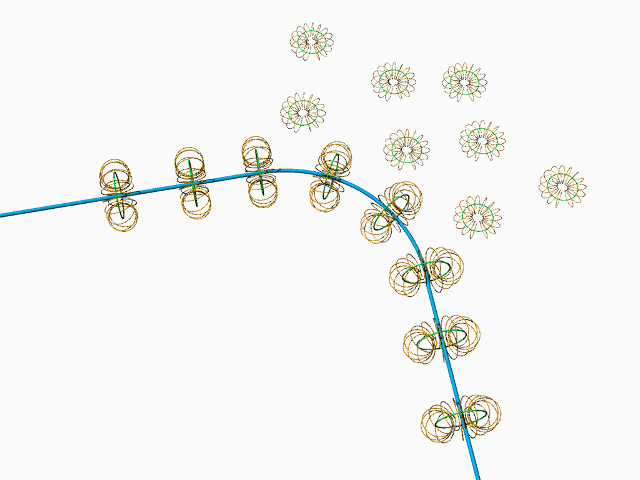 |
| Abb. 13-02-05-02: Eine lineare
Strömung (blau) ist umgeben von
ineinandergeschachtelten Ringströmungen. Bei einem
Bogen entstehen außerhalb weitere Wirbelzellen (FB) |
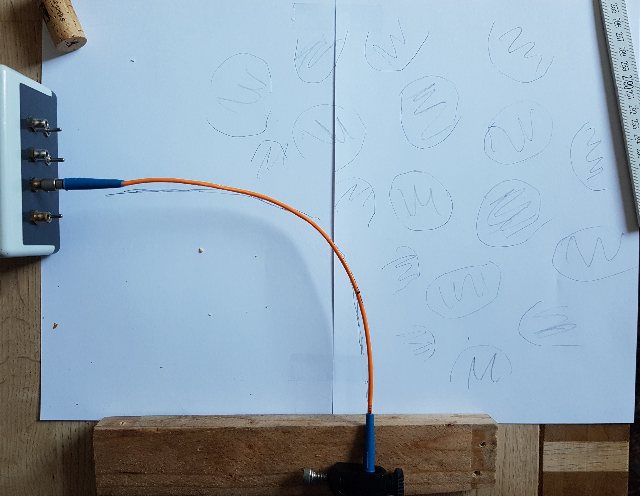 |
| Abb. 13-02-05-03: Lichtleiter als
Viertelkreis, von links wird mit von einer LED
eingestrahlt Es gibt ein schachbrettartiges Muster von Wirbelzellen, jeweils mit abwechselnder Qualität. Die Anzahl der Wirbel pro Fläche nimmt mit steigendem Lichtstrom zu. (FB) |
Winkel der Strukturen auf der Außenseite vom Viertelkreis bei unterschiedlichen Diodenströmen
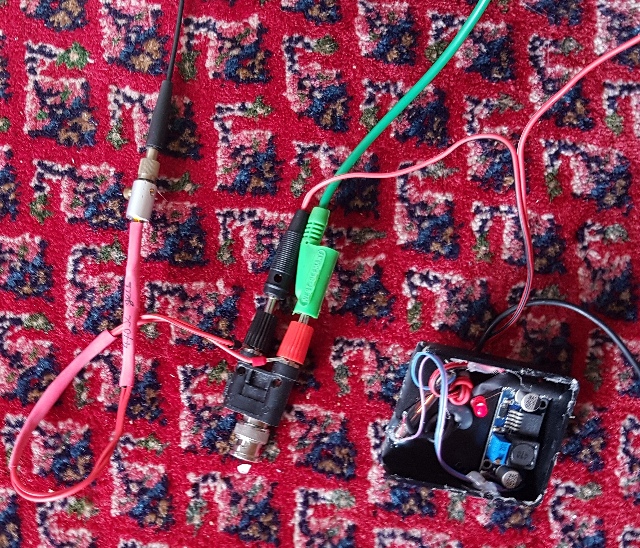 |
| Abb. 13-02-05-04: LED gelb,
integrierter Vorwiderstand 470 Ohm,
step-UP-Wandler 12 Volt, (FB) |
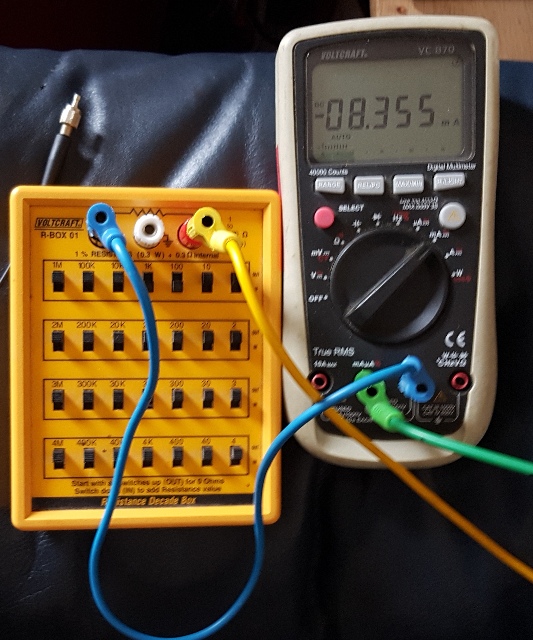 |
| Abb. 13-02-05-05: Diodenstrom
8,3 mA, einstellbarer Vorwiderstand 1100 Ohm, 12
Volt (FB) |
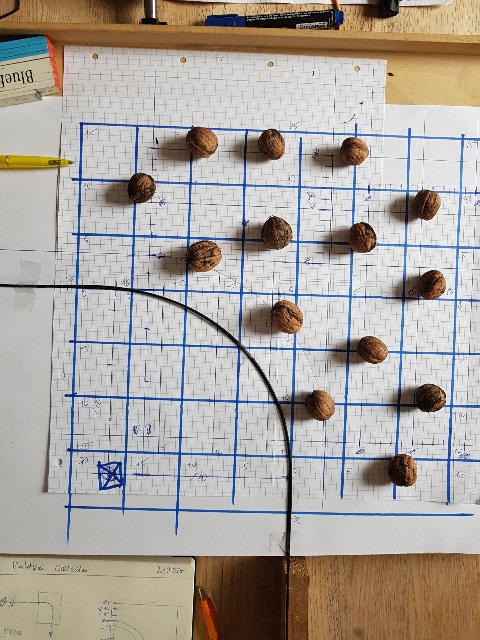 |
| Abb. 13-02-05-06: Diodenstrom:
8.3 mA, es gibt eine matrixartige Anordnung
von Orten mit erhöhter spürbarer Intensität
(Wirbelzellen?). In den Zwischenräumen gibt es
auch Zellern jedoch mit komplementärer
Qualität. Vergleichbar mit den Zellen in Abb. 13-02-02-06 allerdings besteht hier der Abstand zum Viertelbogen viele Meter, während es auf dem Foto nur wenige Dezimeter sind. (FB) |
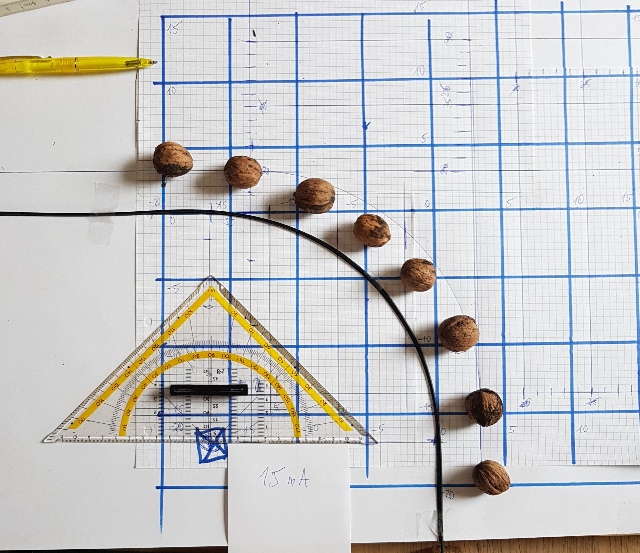 |
| Abb. 13-02-05-07: Diodenstrom:
15 mA |
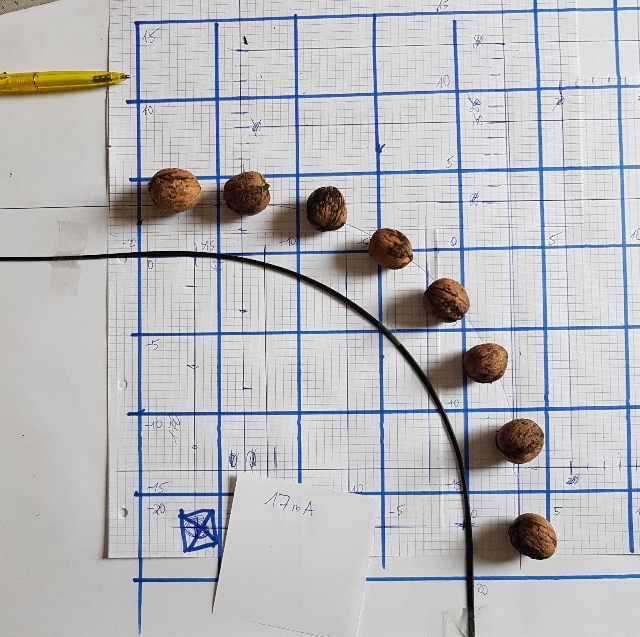 |
| Abb. 13-02-05-08:
Diodenstrom: 17 mA |
 |
| Abb. 13-02-05-09: Diodenstrom:
19.6 mA |
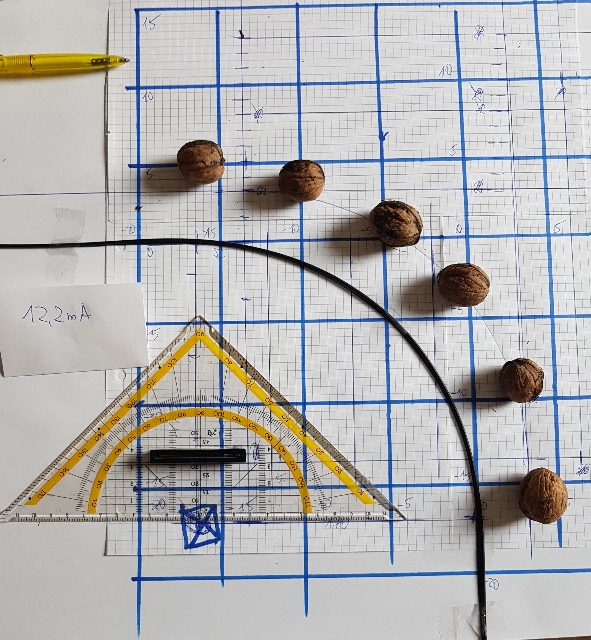 |
| Abb. 13-02-05-10: Diodenstrom: 12.2
mA |
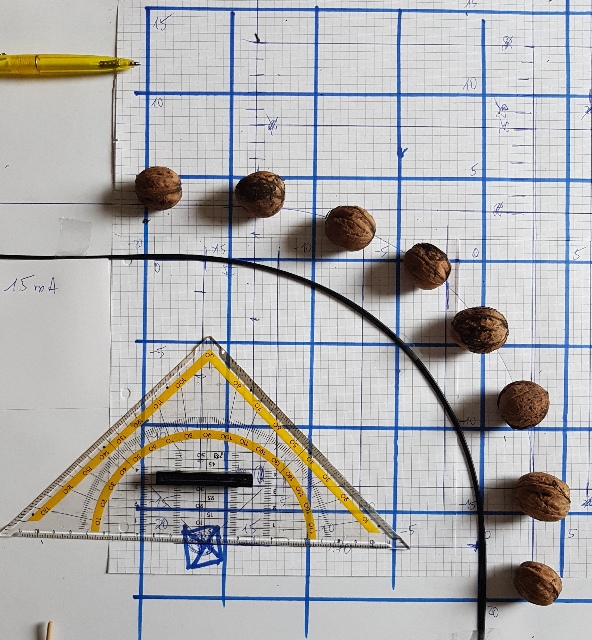 |
| Abb. 13-02-05-11: Diodenstrom: 15 mA |
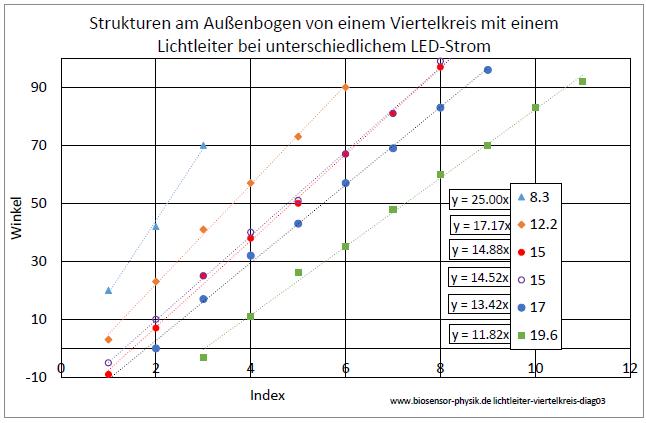 |
| Abb. 13-02-05-12: mit zunehmendem
Diodenstrom (Intensität der LED) werden die Wirbel
immer kleiner und rücken dichter zusammen (FB) |
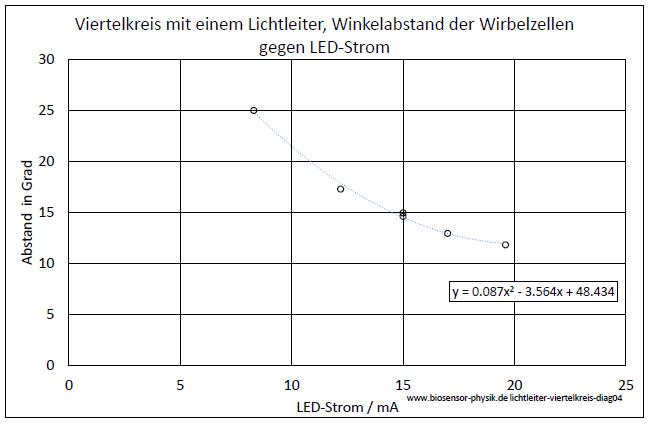 |
| Abb. 13-02-05-13: mit zunehmendem Diodenstrom (Intensität der LED) rücken die Wirbel dichter zusammen (FB) |
13.3 rotierende Objekte, Magnet, geladene Kugel, Rohre, Glaskugel, Lehmkugel
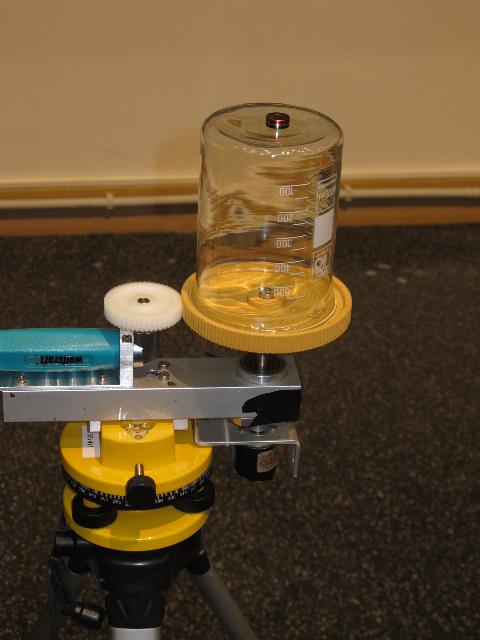 |
Abb. 13-03-01: Rotierender
Ringmagnet 13.01.2012aus kuehlwasser-sechszehn.htm |
 |
Abb. 13-03-02: Scheibe mit vier
Zylindermagnetenaus physik-neu-004.htm#physik-neu-04 |
 |
Abb. 13-03-03: Hochspannung, geladene
Kugel rotiert 27.01.2015aus kuehlwasser-sechszehn.htm |
 |
Abb. 13-03-04: zwei ineinander
gesteckte Metallrohre rotieren gemeinsam um eine
Achse, 27.01.2012aus kuehlwasser-sechszehn.htm |
Amorphe Materialien
 |
Abb. 13-03-05: aus Lehm geformte
Kugel rotiert, 16.6.2015aus kuehlwasser-zwanzig-zwei.htm#kapitel-10 |
 |
Abb. 13-03-06: 10.07.2015aus kuehlwasser-zwanzig-zwei.htm#kapitel-10 |
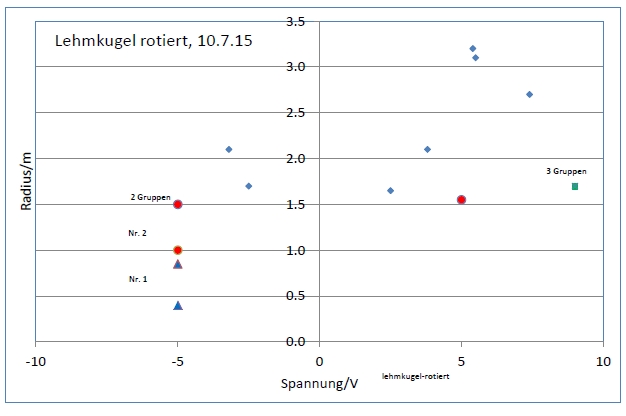 |
Abb. 13-03-07:
aus kuehlwasser-zwanzig-zwei.htm#kapitel-10 |
 |
Abb. 13-03-08:
aus kuehlwasser-zwanzig-zwei.htm#kapitel-10 |
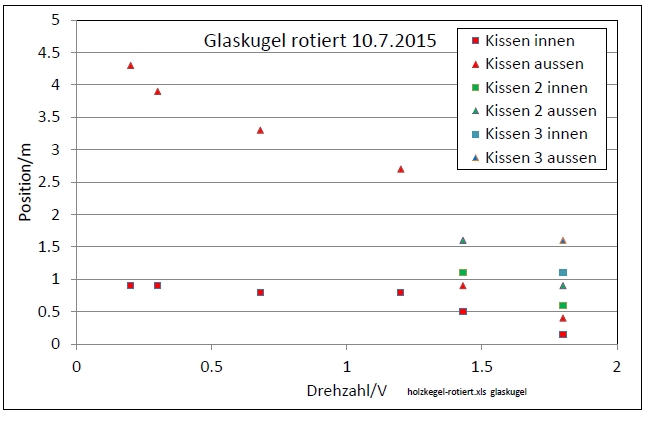 |
Abb. 13-03-09:
aus kuehlwasser-zwanzig-zwei.htm#kapitel-10 |
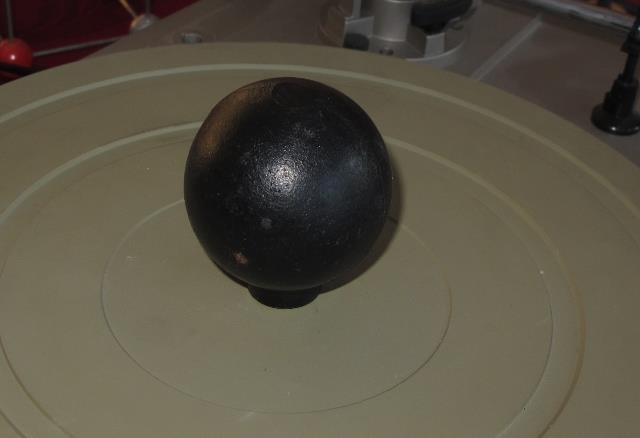 |
Abb. 13-03-10:
aus physik-neu-009.htm#physik-neu-09 |
 |
Abb. 13-03-11:
|
Literatur: b-literatur.htm
 |
www.biosensor-physik.de | (c)
12.04.2020 - 11.08.2025 F.Balck |
© BioSensor-Physik 2025 · Impressum