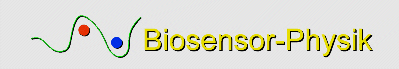Beobachtungen:
Wärmestrahlung, Wärmestrom, elektrische Spannung,
mechanische Spannung
1.1 Klassische Wärmestrahlung
1.2 Thermische Emission
1.3 Weitere Strahlung von glühenden Körpern
2. Andere Art von Strahlung bei schwach erwärmten bzw. heißen Körpern
2.1 erwärmte Metallkörper
2.2 glühender Eisendraht mit Gleichstrom erhitzt
2.3 Glühdraht einer 12 V Glühbirne, Draht einer Feinsicherung
2.4 Strahler mit Halogenstab 500 W
3. Warmes Wasser
3.1 Warmes Wasser im Porzellanbecher
3.2 Unterschied - wärmer oder kälter als die Umgebung
3.3 Warmes Wasser im gläsernen Isolierglas
3.4 Wärmezufuhr erzeugt Strukturen wie bei Strömungen
3.5 Wärmestrahlung, Kältestrahlung
4. Sonstiges
4.1 Pyramide, Chestahedron
4.2 Spürbare Strukturen bei Pyramiden
4.3 Zusätzliche Anregung mit einem elektrische Feld
4.4 Elektrische und mechanische Spannung sowie Erwärmung
4.4.1 Mechanische Spannung
4.4.1.1 Vergleich mit einem hängenden Stab
4.4.1.2 Vergleich mit Belastung einer Spiralfeder (Federwaage)
4.4.1.2a Struktur bei einer Kugelschreiberfeder unter veränderter Belastung
4.4.1.3 Latente Wärme in Flüssigkeit gespeichert, Kalt-Warm-Kompressen
4.4.2 Orbital von einem Bleiklotz als Detektor
4.4.2.1 Einfluß einer elektrischen Spannung, Seebeck-Effekt
4.4.2.2 Einfluß einer mechanischen Spannung
4.4.3 Einfluß von Erwärmung
4.4.3.1 Orbital vom Bleiklotz als Detektor für Anregungen
4.4.3.2 Wirbelzonen als Detektor für Strömungen
4.4.4 Einfluß einer sehr kleinen Gleichspannung bei einem Stab (ohne elektrischen Kontakt!)
4.4.5 Strömungen bei mechanischen Spannungen
4.4.6 Strömung bei einem aktiven Körper
5. Sonstiges-2
5.1 Festkörpereigenschaften
5.2 Eisenbahnschienen als Thermometer (1)
5.3 Eisenbahnschienen als Thermometer (2), Beobachtungen an Fotos von Schienen
5.4 Ideale Gase
5.5 Strömung durch Bewegung
5.6 Strömung bei einem Laserstrahl
Photozelle
photozelle.htm#kapitel-05
N-Strahlung
n-strahlung.htm
Lichtbündel
licht-experimente.htm#kapitel-05
 |
Abb. 00-01: Austritt, "es kommt etwas
heraus", Austrittsarbeit
|
1.1 Klassische Wärmestrahlung
Klassische Wärmestrahlung geht sichtbar von glühenden Körpern aus.
Es gibt aber auch Strahlung von nur schwach erwärmten (d.h. nicht sichtbar glühenden) Körpern.
Diese Strahlung läßt sich mit einer Wärmebildkamera nachweisen, aber auch z.B. mit der Haut auf dem Handrücken.
 |
| Abb. 01-01-01: Unterschiedliche
Farben bedeuten unterschiedliche Temperaturen. In der Nähe der Stromzuführungen ist es kälter, daher sieht man zum Teil Farben von Hellgelb bis Dunkelrot. aus lichtquellen.htm#kapitel-04 |
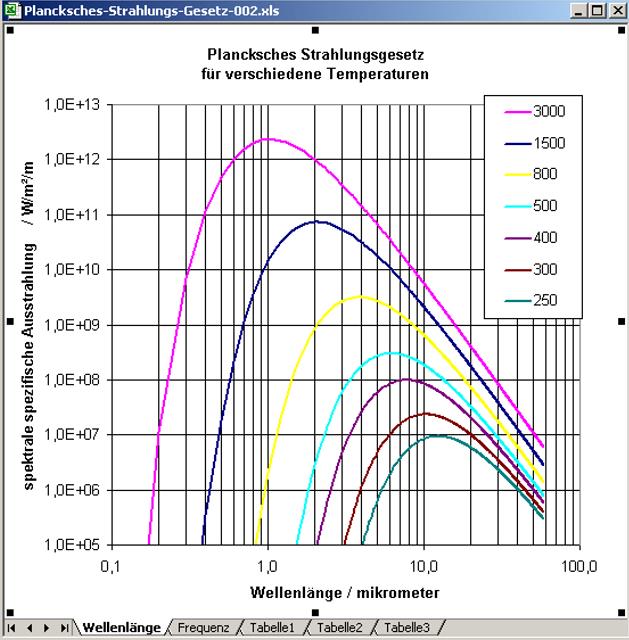 |
Abb. 01-01-02:
aus planck-strahlung.htm |
1.2 Thermische Emission
Aus heißen Metallen treten Ladungsträger aus. Man kann sie mit einem elektrischen Feld absaugen, sofern der Luftdruck sehr niedrig ist, d.h. wenn sich der Aufbau im Vakuum befindet.
Restliche Gasmoleküle sind der Grund dafür, daß die Ladungen auf ihrem Weg zum Auffänger behindert werden.
Je weniger Gasteilchen vorhanden sind, um so mehr Ladungsträger gelangen zum Auffänger.
Dieser Zusammenhang läßt sich in einem Vakuum-Meßgerät ausnutzen.
Glühemission: felder.htm#kapitel-04-06-02
 |
| Abb. 01-02-01: oben: Heizdraht
(weißer Draht), aus dem beim Glühen die
Ladungsträger austreten (Glühemission) , Wendel (zum kurzzeitigen Ausheizen d.h. Reinigen der Elektroden) in der Mitte: Auffänger-Elektrode für die Ladungsträger (FB) |
 |
| Abb. 01-02-02: Meßbereich von
10-2 bis 10-8 mbar untere Skala: Heizstrom für die Glühemission 0,1 mA (FB) |
 |
Abb. 01-02-03: Glühkathode, Aufbau
wie im Röhrenfernseher oder
Kathodenstrahl-Oszillograph. aus beschleunigte-ladungen.htm#kapitel-01 |
1.3 Weitere Strahlung von glühenden Körpern
N-Strahlen, N rayons von R. Blondlot
n-strahlen.htm
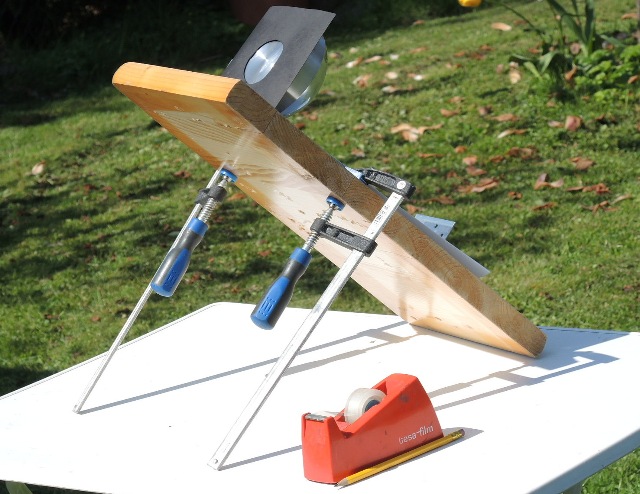 |
Abb. 01-03-01: Die Sonne scheint auf
die Aluminiumlinse. Im Schattenbereich können
sensitive Personen Teilchenstrahlung (N-Strahlen)
finden, die durch die Linsenform "gebündelt" werden.
Es gibt mehrere "Brennpunkte", d.h. es sind dort
einige Stellen mit höherer spürbarer Intensität.aus n-strahlung.htm#kapitel-03-02-02 |
 |
| Abb.01-03-02: Gaslaterne mit vier
Glühstrümpfen (FB) |
 |
abb. 01-03-03: Gaslampe mit
Glühstrumpf, ähnlicher Aufbau wie von Blondlot
benutzt. Er hatte eine Auer-Lampe (Glühkörper) zur
Verfügung.aus n-strahlung.htm#kapitel-03-02-02 |
 |
| Abb. 01-03-04: Halogenlampe als
Glühkörper. Auf dem Papier sind mehrere Striche zu sehen, die einzelne "Brennpunkte" markieren. aus n-strahlung.htm#kapitel-03-02-02 |
2. Andere Art von Strahlung bei schwach erwärmten bzw. heißen Körpern
2.1 erwärmte Metallkörper
Ist ein Körper wärmer als seine Umgebung, vergrößert sich dessen spürbare Struktur, die ihn umgibt.
Deren Erweiterung hängt von der Temperaturdifferenz zur Umgebung ab.
Es reichen schon Temperaturunterschiede von wenigen Grad aus für einen merkbaren Effekt..
 |
Abb. 02-01-01: geheizte Kupferplatte
mit Thermoelement aus aktive-elemente.htm#kapitel-01-03 |
 |
| Abb. 02-01-02: Radius der Struktur um
die Kupferplatte gegen die Temperatur. Linearer Zusammenhang: 100° Temperaturunterschied entspricht etwa 100 cm Zunahme (FB) |
 |
Abb. 02-01-03: Kupferzylinder, mit
der Gasflamme erwärmbar. aus aktive-elemente.htm#kapitel-01-03(FB) |
 |
Abb. 02-01-04: Messingzylinder,
mit der Gasflamme erwärmbar. aus seums.htm#kapitel-03-02 |
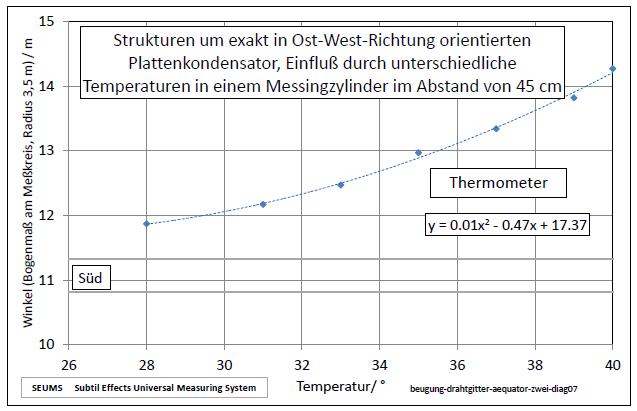 |
| Abb. 02-01-05: Mit zunehmder
Temperatur des Messingzylinders, nimmt die
Intensität der Struktur zu. gemessen als Öffnungswinkel beim SEUMS. aus seums.htm#kapitel-02 |
 |
Abb. 02-01-06: Um diese Hohlkugel
aus Edelstahl gibt es bei etwa 20° ein
Orbital mit Radius von etwa 3,8 Meter. Es wächst mit
zunehmender Temperatur.aus kugel-orbital.htm#kapitel-02 |
 |
Abb. 02-01-07: blaue Kurve der Radius
wächst mit zunehmender Temperatur: pro 1
K 1/11 m ~ 9 cmaus kugel-orbital.htm#kapitel-02 |
2.2 glühender Eisendraht mit Gleichstrom erhitzt
 |
| Abb. 02-02-01: Glühender Eisendraht, 0,5 mm, ca. 6 A Gleichstrom (FB) |
 |
| Abb. 02-02-03: Drei Netzteile
parallel geschaltet liefern maximal 9 A Gleichstrom.
(FB) |
 |
| Abb. 02-02-03: Der Radius des
Orbitals wächst mit zunehmender Leistung linear an
mit etwa 1 cm pro Watt. (Leistung ist etwa
proportional zur Temperatur) (FB) |
2.3 Glühdraht einer 12 V Glühbirne, Draht einer Feinsicherung
 |
| Abb. 02-03-01: Gleicher Aufbau mit
einer Glühlampe aus dem Auto, Sofittenlampe (12V) Die Ausdehnung des inneren und äußeren Orbtials wird entlang vom Maßstab aufgenommen. Der Maßstab liegt in Nord-Süd-Richtung. (FB) |
 |
| Abb. 02-03-02: Bestimmung der Radien
in Nord- (rechts) und Südrichtung (links) Links das Netzgerät für Gleichstrom. (FB) |
 |
Abb. 02-03-03: Radien vom inneren und
äußeren Orbital in Nord- und in Südrichtung bei
unterschiedlichen Leistungen (Temperaturen)
|
 |
| Abb. 02-03-04: Metallspiegel,
Oberflächenspiegel Wenn die Spiegelseite zur Lampe zeigt, wird die Ausbreitung des Orbitals nach rechts etwas schwächer Bei umgekehrter Ausrichtung des Spiegels gibt es rechts hinter dem Spiegel keine Struktur. (FB) |
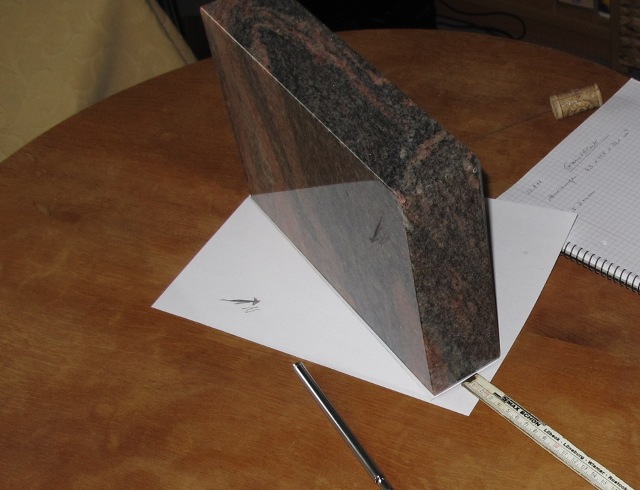 |
Abb. 02-03-05: Auch bei dieser
Sofitte geht die spürbare Struktur durch diesen
Granitklotz hindurch mit kaum wahrnehmbarer
Zeitverzögerung.aus aktive-elemente.htm#kapitel-01-03 |
 |
| Abb. 02-03-07: Feinsicherung für
0,315 A, betrieben mit einigen mA (FB) |
 |
| Abb. 02-03-08: Versorgung mit
Gleichstrom aus einer USB-Spannungsquelle (oben in
der Mitte) Spannungsregler und Spannungsteiler (FB) |
 |
| Abb. 02-03-09: Feinsicherung, 0,315
A, der Maßstab zeigt nach Süden. Es gibt eine Struktur mit vier um die Drahtachse konzentrischen Elementen. (FB) |
 |
| Abb. 02-03-10: Die jeweiligen Radien
der vier Strukturen nehmen mit der elektrischen
Leistung zu. Die Elemente haben etwa gleichen Abstand voneinander. (FB) |
wasser-ader-zwei.htm#kapitel-09-01
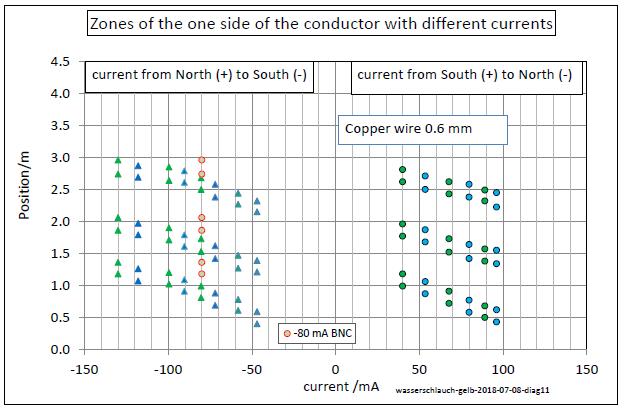 |
Abb. 02-03-11: horizontaler
Stromleiteraus wasser-ader-zwei.htm#kapitel-09-01 |
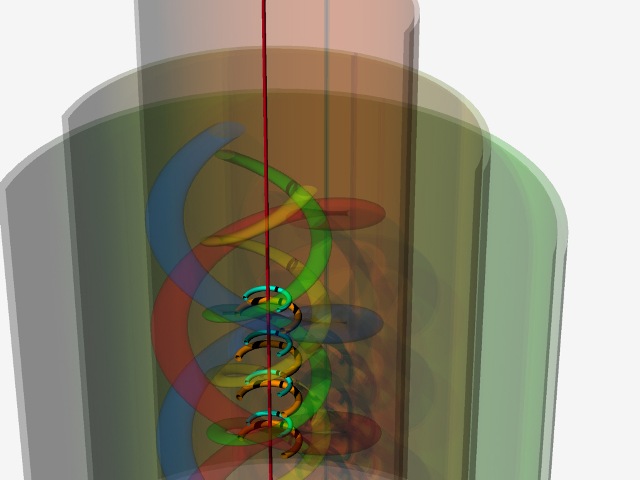 |
Abb. 02-03-12: vertikaler Stromleiteraus wasser-ader-zwei.htm#kapitel-09-01 |
2.4 Strahler mit Halogenstab 500 W
Beobachtung:
In Strahlrichtung gibt es eine spürbare Struktur mit zwei Keulen.
Wenn die Blickrichtung Ost ist, d.h. die Drahtwendel exakt in Nord-Süd ausgerichtet ist,
dann gibt es ein Minimum bei der Länge der Keulen.
 |
| Abb. 02-04-01: Dieser
Halogen-Strahler ist für 500 W bei 230 Volt
ausgelegt. Beim Betrieb mit etwa 30 Volt leuchtet er schwach in gelblicher Farbe. Bei den nachfolgenden Versuchen ist die elektrische Leistung erheblich geringer. Die Glühwendel leuchtet nicht. (FB) |
 |
| Abb. 02-04-02: Die Glühwendel
befindet sich in einem Quarzrohr. Bei diesen
geringen Strömen leuchtet sie nicht. Schon beim Betrieb mit etwa 2 Volt (73 mA 150 mW) gibt es eine spürbare Struktur mit Radius von etwa 1,5 m. Bei 3 V (115 mA, 350 mW) sind es rund 2,2 m Blickrichtung Ost Die Länge der Struktur hängt von der Orientierung des Strahlers ab. Angaben für Ausrichtung nach Osten. (FB) |
 |
| Abb. 02-04-03: Netzteil für
Gleichspannung (FB) |
 |
| Abb. 02-04-04: Nach Einschalten des
Stromes entsteht eine spürbare Struktur in Richtung
der Scheinwerferöffnung. Diese 80 mm starke
Holzfaserplatte (Dachisolierung) bewirkt, daß die
Struktur erst nach wenigen Sekunden hindurchgeht und
sich danach allmählich weiter ausbreitet. "Abschirmkork sollte hochverdichtet sein, damit er sich nicht auflädt" frei nach Kopschina abschirmung.htm /kopschina 2001/ (gilt für Ausrichtung nach Osten) (FB) |
 |
| Abb. 02-04-05: Diese Granitplatte
behindert die Ausbreitung einer spürbaren Struktur
nicht. Die Wirkung geht hindurch. (gilt für Ausrichtung nach Osten) (FB) |
 |
| Abb. 02-04-06: Steht ein Mensch mit
dem Oberkörper vor dem Scheinwerfer, wird die
spürbare Struktur nicht durchgelassen. Sie wird vom
Körper reflektiert. (gilt für Ausrichtung nach
Osten) (FB) |
3. Warmes Wasser
3.1 Warmes Wasser im Porzellanbecher
- Man fülle einen Trinkbecher mit Wasser bei
Raumtemperatur und
bestimme den Radius der den Becher umgebenden spürbaren Struktur.
- Anschließen wiederhole man die Messung mit warmem
Wasser,
nachdem man etwa eine Minute gewartet hat, bis sich die Becherwandung erwärmt hat. - Danach bestimme man den Radius erneut.
- Anschließend trinke/gieße man die Hälfte vom
Wasser wieder aus und bestimme erneut den Radius.
(Experiment für die Kaffeepause)
- Bei warmem Wasser ist die Struktur sehr viel größer als bei kaltem Wasser.
- Halbiert man die Menge des warmen Wasser, schrumpft sie erheblich.
- Die Oberflächentemperatur der Becherwand hat sich
dabei nicht merklich verändert.
Also kann die Ursache für die Struktur nicht die Oberflächentemperatur des Bechers sein,
d.h. es handelt sich nicht die Wärmestrahlung im klassischen Sinne!
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abb. 03-01-01: Becher steht auf einem
Holzbrett auf einer Küchenwaage. Die Temperatur wird
mit einem Thermoelement gemessen. Die Kamera blickt
in Richtung Süden. Nach links (Süd) und rechts
(Nord) gehen zwei Maßstäbe. In diesen Richtungen
werden die Radien des inneren und des äußeren
Orbitals bestimmt. (FB) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abb. 03-01-02: nach links geht es in
Richtung Süden. Es gibt ein inneres und ein äußeres
Orbital. (FB) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abb. 03-01-03: Versuch 1 und Versuch
3, Radien von innerem und äußerem Orbital Unterschiedliche Mengen von warmem Wasser im Trinkbecher bei etwa 68° Radien in Süd-Richtung S1 und S3 bzw. in Nord-Richtung N1 und N3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abb. 03-01-04: Versuch 2 Radien
von innerem und äußerem Orbital Gleiche Menge von warmem Wasser bei unterschiedlichen Temperaturen.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abb. 03-01-15: Warmes bzw. kaltes
Wasser im Becher, jeweils halbvoll bzw. voll. Die gestrichelten Linien rot und blau sind nahezu parallel. Daraus folgt:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 Unterschied - wärmer oder kälter als die Umgebung
Um jedes der beiden Objekte gibt es ein Orbital, dessen Durchmesser mit der Temperturdifferenz zur Umgebungstemperatur zunimmt. Für kalt und warm gibt es Orbitale mit unterschiedlich spürbaren Qualitäten.
 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Abb. 03-02-01: Zwei Becher mit
Wasser, links: Wasser etwa 20° wärmer als die Raumtemperatur, rechts: Wasser etwa 15 ° kälter als die Raumtemperatur (FB) |
||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Abb. 03-02-02: Becher mit
Schneewasser, Maßstab in Richtung Süden (FB) |
||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Abb. 03-02-03: Die Radien der
Orbitale nehmen mit dem Betrag der Differenz
zwischen Umgebung- und Wassertemperatur zu.
Die beobachteten Strukturen bestehen aus zwei Elementen mit Radius-1 und Radius-2 Becher mit Schneewasser:
Becher mit warmem Wasser:
|
 |
||||||||||||
| Abb. 03-02-03: Teekanne mit Wasser
steht auf einem Holzbrett, Temperatur des Wassers: 20°, der Schneeschicht: 0° (FB) |
||||||||||||
 |
||||||||||||
| Abb. 03-02-04: Es wird die Ausdehnung
des Orbitals in Richtung Süden bestimmt. (FB) |
||||||||||||
|
3.3 Warmes Wasser im gläsernen Isolierglas
Gibt man warmes Wasser in ein gläsernes Isolierglas, so erwärmt sich dessen Außenwand sehr viel langsamer als bei einem einfachen Glas. Für eine Wärmebildkamera ist das warme Wasser "unsichtbar", sie mißt lediglich die Außentemperatur des Isolierglases.
Die spürbare Struktur (Orbital) um das warme Wasser herum ist sofort nach dem Eingießen vorhanden und verändert nicht ihre Größe, während das äußere Glas sich erwärmt.
----> Kamera "sieht" nur einen Teil der Wärmestrahlung.
 |
| Abb. 03-03-01: Wärmebildkamera, Thermoelement und Isolierglas mit warmem Wasser gefüllt. (FB) |
 |
| Abb. 03-03-02: Wasserglas mit warmem Wasser und Thermoelement (FB) |

 |
| Abb. 03-03-03: Bilder der
Wärmebildkamera (der Temperaturbereich ist bei beiden Bildern gleich, "fixed" ) Von oben, direkt auf das Wasser erscheint eine Temperatur von 75,7°, von der Seite gesehen ist die Temperatur bei 43,8° Nach dem Einfüllen des warmem Wassers in das Glas, war das Glas außen auf Zimmertemperatur. Die Außentemperatur stieg allmählich an. (FB) |
Glasscheiben beschichtet mit ZinnOxid ITO
 |
| Abb. 03-03-04: Glasscheibe,
einseitig mit ITO (IndiumTinOxyde) beschichtet. Ein Teil der spürbaren Strukturen geht durch die Scheibe hindurch. Welche Seite der Scheibe zur Tasse zeigt, hat einen Einfluß: noch Forschungsbedarf. (FB) |
3.4 Wärmezufuhr erzeugt Strukturen wie bei Strömungen
Einige Vorversuche: Anregung für diese Experimente zur Wärmeleitung kommen von hier:
Die "Strömung" in einem stabförmigen Objekt läßt sich an ihrer Wirkung erkennen: es gibt spürbare Strukturen um den Stab herum.
Für die Detektion der Strukturen ist eine Ummantelung (Durchführung) z.B. durch Sand erforderlich.
Es verhalten sich hierbei ähnlich: fließendes Wasser, strömende Luft, fließender elektrischer Strom, Licht in einem Lichtleiter
und Wärmefluß.
Und zwar reicht beim Wärmefluß auch schon die Erwärmung in einem kurzen Bereich von wenigen Prozent der Länge.
Die spürbaren Strukturen sind über der ganzen Länge zu finden.
 |
Abb. 03-04-01:aus maxwell-drei.htm#kapitel-04-04-02 |
 |
Abb. 03-04-02:
aus maxwell-drei.htm#kapitel-04-04-02 |
 |
Abb. 03-04-03: Nur etwa 3 cm erhitzt.aus maxwell-drei.htm#kapitel-04-04-02 |
" Es fließt etwas vom Warmen zum Kalten."
- Bei Stäben aus Metall, Holz oder Kunststoff führt kurzzeitige
Erwärmung (fünf Sekunden) mit der warmen Hand zu torusartigen
Strukturen, wie sie bei Strömungen z.B. Luft, Wasser in
einem Rohr; Strom in einem Leiter oder Licht in einer
Faser zu beobachten sind. Torusradius > 0,5 m. wasser-ader-zwei.htm
Etwa 10 Sekunden nach der Erwärmung sind die Tori wieder zusammengefallen. (Daten gelten für 15 mm Aluminiumstab) - Damit verbunden ist eine Vergrößerung der Keulen am
nicht erwärmten Ende.
- Erwärmt man den Stab in der Mitte, verlängern sich die Keulen an beiden Enden entsprechend.
 |
| Abb. 03-04-04: Stäbe aus v. l.: Buche, geriffelter Buche, Aluminium, Kupfer, Stahl, Messing, Plexiglas und weißer Kunststoff (FB) |
 |
| Abb. 03-04-05: Ein langer 15 mm
Aluminiumstab, ein kurzer 12 mm Eisenstab (Stahl)
und ein langer Stab aus Buchenholz. (FB) |
 |
| Abb. 03-04-06: Erwärmung an einem
Ende Jeder der Stäbe ist ein aktiver Körper, bei dem an jedem Ende keulenartige Strukturen vorhanden sind. Die spürbaren Qualitäten beider Keulensysteme unterscheiden sich.  Schematisch: für System gelb im Gleichgewicht z.B. Keule links lang, Typ A Keule rechts kurz Typ B <--Keule-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ----K--< (1) (2) Erwärmt man einen dieser Körper mit der warmen Hand oder mit dem Feuerzeug ( ca. 5 Sekunden) z.B. bei (1) , dann sieht das Bild für einige Sekunden so aus: TTTTTTTTTTTTorusTTTTTTTTTTTTT --K----- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----Keule------>+> TTTTTTTTTTTTorusTTTTTTTTTTTT Erwärmt man ihn bei (2), dann ist es etwa spiegelbildlich: TTTTTTTTTTTTorusTTTTTTTTTTTTTTT <+<-----Keule------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ----K--< TTTTTTTTTTTTorusTTTTTTTTTTTTTTT (FB) |
 |
| Abb. 03-04-07: System gelb und
System rot, schematisch Keulenorbitale auf beiden Seiten, Verhältnis der Längen für gelb etwa 2:1, für das entsprechend gespiegelte Paar mit einer anderen Qualität ist das Verhältnis umgekehrt 1:2 (FB) |
 |
| Abb. 03-04-08: Eisenstab, die Längen
der Keulen rot und gelb sind mit Hölzern markiert
(ohne Erwärmung). Sie sind etwa im Verhältnis 1:2 bzw. 2:1 Es gibt auf jeder Seite jeweils zwei Keulen. vorher , System gelb <------------- xxxxxxxxxxxxxxxx-----< (3) Nach Erwärmung in der Mitte dehnen sie sich in beide Richtungen aus. nach etwa drei Sekunden Erwärmung mit dem Feuerzeug <+<------------------------ xxxxxxxxxxxxxxxx------------------->+> (FB) |
 |
| Abb. 03-04-09: Zwei Buchenstäbe 12 mm
Durchmesser, glatt und geriffelt. Beim geriffelten Stab reagieren die äußeren Strukturen sehr viel stärker auf leichte Erwärmung mit den Fingern als beim glatten Stab. (FB) |
3.5 Wärmestrahlung, Kältestrahlung
 |
| Abb. 03-05-01: Schnee auf dem Teller,
Temperatur ist wie die Umgebung, keine Struktur
spürbar (FB) |
 |
| Abb. 03-05-02: Schnee auf dem Teller,
im Raum ist es etwa zwanzig Grad wärmer. Es gibt
eine größere Struktur um den Schnee herum, die im
Freien bei Außentemperatur nicht wahrzunehmen war.
(FB) |
 |
| Abb. 03-05-03: Aluminiumstab. Erwärmt
man ihn mit warmen Fingern an unteren Ende für
einige Sekunden, dann gibt es eine torusartige
Struktur entlang des Stabes. Wärmeleitung durch das metallische Leitung (FB) |
u |
| Abb. 03-05-04: Wärmerohre (Heatpipe),
Wärmeleitung durch strömenden Wasserdampf. links: Schneewasser (etwas trübe), rechts: klares warmes Wasser, etwa 15° über Raumtemperatur Die Strukturen um die beiden Wärmerohre unterscheiden sich in der Qualität. (FB) |
 |
| Abb. 03-05-15: Wasser mit gleicher
Temperatur in beiden Flaschen. Berührt man gleichzeitig das linke Wärmerohr und das rechte jeweils mit Daumen und Zeigefinger (anstatt der Wäscheklammern), dann strömt (oberhalb der Schraubdeckel) in dem linken Rohr die Wärme der Finger im Rohr nach unten und im rechten Rohr die Wärme nach oben. Dabei entsteht eine große Wirbelstruktur (Radius > 1 m), die nach dem Entfernen der Finger noch etwa 15 Sekunden anhält und dann kleiner wird. (FB) |
4. Sonstiges
4.1 Pyramide, Chestahedron
30.1.2021
Bei der Ausrichtung von Pyramiden hat die exakte geografische Nord-Richtung eine besondere Bedeutung.
Dies hängt vermutlich mit den beiden Teilchenströmen aus Nord und aus Osten zusammen. seums-vier.htm
An zwei Beispielen konnte die Abhängigkeit bestätigt und um Erkenntnisse erweitert werden.
Übersicht Pyramiden
 |
| Abb. 04-01-01: Pyramide aus
Aluminiumrohr (FB) |
 |
| Abb. 04-01-02: Doppeltetraeder aus
Kupferdraht (FB) |
 |
| Abb. 04-01-03: Doppeltetraeder aus
Kupferdraht zum Aufhängen, Vorschlag von R. Gebbensleben hyperschall.htm (FB) |
 |
| Abb. 04-01-04: Doppeltetraeder aus
Draht (FB) |
 |
| Abb. 04-01-05: Tetraeder aus 6 mm
Kupferrohr, Spitze steckt im Erdreich. (FB) |
 |
Abb. 04-01-05: sehr starke
Ausstrahlung!aus konische-koerper.htm |
 |
| Abb. 04-01-06: Pyramide aus Schungit.
Stark spürbare Effekte. Shungit ist ein in der Natur nur an wenigen Orten vorkommendes schwarzes Gestein präkambrischen Alters, das hauptsächlich aus Kohlenstoff besteht. https://de.wikipedia.org/wiki/Shungit (FB) |
 |
| Abb. 04-01-07: Pyramide aus
Pappkarton, unten offen. (FB) |
 |
| Abb. 04-01-08: Pyramide mit
eingeschriebener zweiten Pyramide (FB) |
 |
| Abb. 04-01-09: Pyramiden und
"Obelisk" (FB) |
 |
| Abb. 04-01-10: Pyramide aus
Stahlblech mit Granitstein auf der Spitze, Lauenburg/Elbe 53°22'13.16"N 10°33'31.68"E |
 |
| Abb. 04-01-11: Pyramiden aus
Edelstahl, es gibt Resonanzen zwischen ihnen,
Abdeckung für den Brunnen vor dem Bahnhof in
Halberstadt (FB) |
 |
| Abb. 04-01-12: Hotel Pyramide,
Europaallee 1, Fürth (FB) |
 |
| Abb. 04-01-13: Pyramide, Stockelsdorf
(FB) |
 |
Abb. 04-01-14:aus kunststoff-pyramiden.htm |
 |
| Abb. 04-01-15: Pyramidenförmige
Bienenwachskerze. Zündet man sie an, dann erzeugt die brennende Flamme eine große Struktur (FB) |
4.2 Spürbare Strukturen bei Pyramiden
 |
Abb. 04-02-01:aus seums-drei.htm#kapitel-08-03 |
 |
| Abb. 04-02-02: Chestahedron Auf den Kanten eines gleichseitigen Dreiecks stehten senkrecht drei gleichseitige Dreiecke. Die Zwischenräume sind aufgefüllt mit drei Vierecken, die sich in der Spitze treffen. Die Vierecke sind Teile von Tetraederflächen. Jede Fläche hat den gleichen Flächeninhalt. http://frankchester.com/project/chestahedron/ Bauplan: http://frankchester.com/wp-content/uploads/2010/07/Chestahedron-Net-with-Face-angles.jpg (FB) |
 |
| Abb. 04-02-03: Ausgeschnitten aus
Papier 80g/m² (FB) |
 |
| Abb. 04-02-04: Beobachtung: Wenn das Hedron mit der Basis (Dreieck) auf dem Tisch steht, dann strömt etwas heraus - von der Seite gesehen - wie bei einem Blumenstrauß. Von der Spitze kommt etwas mit Qualität 1, von den drei "Hilfsspitzen" etwas mit Qualität 2, Höhe der Struktur: etwa 40 cm. In der vertikalen Achse gibt es eine Rotation (Schraube) bis über 1,5 m hoch. Wenn eine Kante der Basis exakt parallel zur Nord-Süd-Richtung steht, dann wird die Struktur schmal und reicht weit nach oben. Zeigt der dritte Punkt vom Dreieck nach Westen, dann ist der " Blumenstrauß" zylindrisch, etwa 10 cm im Durchmesser und ungefähr 1,5 m hoch. Zeigt der dritte Punkt nach Osten, dann ist oberhalb vom Hedron alles verschwunden. Die Struktur zeigt nach unten. Anmerkung: es gibt eine weitere Struktur mit komplementärer Qualität, die sich bezüglich der Grundfläche spiegelbildlich verhält. (FB) |
Eine Pyramide zum Vergleich
Beobachtung:
 |
| Abb. 04-02-05: Pyramide aus Alabaster
(FB) |
 |
| Abb. 04-02-06: Ausrichtung der
rechten Kante in Richtung NO. Die Richtung der Rillen in der Unterlage ist exakt NO. Die Struktur dreht CW. (FB) |
 |
| Abb. 04-02-07: Ausrichtung der
Paramide exakt in NS-Richtung, keine Drehung (FB) |
 |
| Abb. 04-02-08: Ausrechtung der
rechten Kante in NW-Richtung. Drehrichtung CCW (FB) |
Versuch der Erklärung
  |
  |
| Abb. 04-02-09: schematisch:
Wechselwirkung mit den beiden Teilchenströmen aus
Ost und Nord. seums-vier.htm Ist die Grundfläche der Pyramide etwas nach NO verdreht, stehen die Seitenflächen nicht mehr senkrecht zu den beiden Strömen. Es gibt eine CW- Rotation. Bei Verdrehung nach NW ist die Drehrichtung umgekehrt, CCW - Rotation (FB) |
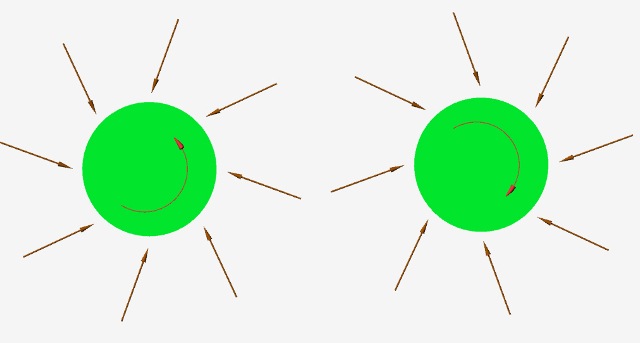 |
Abb. 04-02-10: Mechanisches Modell,
schematisch, links CCW, rechts CWaus steinkreise-06.htm#kapitel06 |
 |
Abb. 04-02-11: CWaus steinkreise-06.htm#kapitel06-2 |
 |
Abb. 04-02-12: CCWaus steinkreise-06.htm#kapitel06-2 |
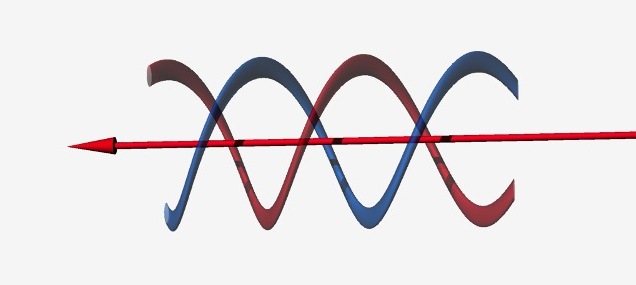 |
| Abb. 04-02-12: Fundamentales Gesetz
Jede Bewegung (linear) ist gekoppelt mit
schraubenförmigen Strukturen in der
Feinstofflichkeit oder auch
Grobstofflichkeit. (FB 1.2.2021) |
1.2.2021 Erweiterung
4.3 Zusätzliche Anregung mit einem elektrische Feld
Beobachtung:
Wenn die Pyramide bezüglich der NS-Richtung fehlorintiert ist, dann hat die Struktur über der Pyramidenspitze einer rotierende Komponente. Im nachfolgenden Bild rotiert sie CCW.
Legt man zwischen den beiden Kontakten eine einstellbare Gleichspannung - Minuspol (weiß), Pluspol (rot)), dann wird die Struktur (Qualität 1) kleiner, die Rotation verschwindet bei etwa 2,5 µV und kehrt bei höheren Spannungen ihre Drehrichtung (z.B. 6,0 µV) um. Die bisher oben beobachtete Struktur (Qualität 1) ist dann auf der Unterseite der Pyramide zu finden.
Auf der Oberseite ist dann stattdessen eine Struktur mit der Qualität 2.
Vertauscht man die Pole in der Zuleitung, dann wächst die Struktur (Qualität 1) auf der Oberseite mit zunehmender Spannung an.
Mit diesem Testaufbau läßt sich ein Maß für die Stärke der Rotation finden ==>
dieses Maß ist die Spannung, bei der sich die Rotation umkehrt.
 |
| Abb. 04-03-01: Nordrichtung oben.
Unterlage ist exakt N-S. Die Abschirmungen der beiden Zuleitungen und das Steckergehäuse sind jeweils über den Schutzkontakt vom Stromnetz geerdet. Nur die Kontaktstifte sind erdfrei und mit der USB-Spannungsquelle verbunden. Die Gleichspannung ist im Bereich von + / - 10 µV einstellbar (FB) |
 |
| Abb. 04-03-02: Seitenansicht. (FB) |
 |
| Abb. 04-03-03: Einspeisung in die
beiden Audio-Kabel (links), grün: geerdet, blau bzw. rot Spannungsquelle (FB) |
 |
| Abb. 04-03-04:
USB-Spannungsquelle mit Spannungsteiler und Helipot
zur Feineinstellung. Das grüne Meßgerät zeigt die Spannung (0,25 V) am Spannungsteiler 10 000 Ohm zu 0,1 Ohm. Am Ausgang steht somit 0,25 V / 10 000 * 0,1 = 2,5 µV Bei 4 cm Elektrodenabstand ist die Feldstärke bei der Pyramide 62,5 µV/m (FB) |
 |
| Abb. 04-03-05: Auch beim Würfel aus
Graphit gilt die gleiche Beobachtung für die Wirkung
der Teilchenströme aus Nord und Ost. Beim Drehen um die vertikale Achse und Überschreiten der N-S-Richtung wechselt die Qualiät der Struktur über dem Würfel ( CCW und CW) (FB) |
 |
| Abb. 04-03-06: Auch für diese
Zaunpfahlkappen aus Aluminium gilt die Beobachtung.
In der Nähe der exakten Ausrichtung N-S ändert sich die Qualität der Struktur. konische-koerper.htm#kapitel-03-03 (FB) |
4.4 Elektrische und mechanische Spannung sowie Erwärmung
4.4.1 Mechanische Spannung
 |
Abb. 04-04-01-01: Das obere Ende
eines 1 m langen Aluminiumstabes wird um wenige
1/100 mm zur Seite gebogen. Bei exakter
senkrechter Ausrichtung des Balkens gibt es keine
Biegekräfte durch die Schwerkraft. Mit der
Stellschraube lassen sich die Verbiegungen sehr fein
einstellen.aus kuehlwasser-zwanzig.htm#kapitel-02-01 |
 |
Abb. 04-04-01-02: Bei mechanischer
Spannung entstehen Zonen längs des Balkens.aus kuehlwasser-zwanzig.htm#kapitel-02-01 |
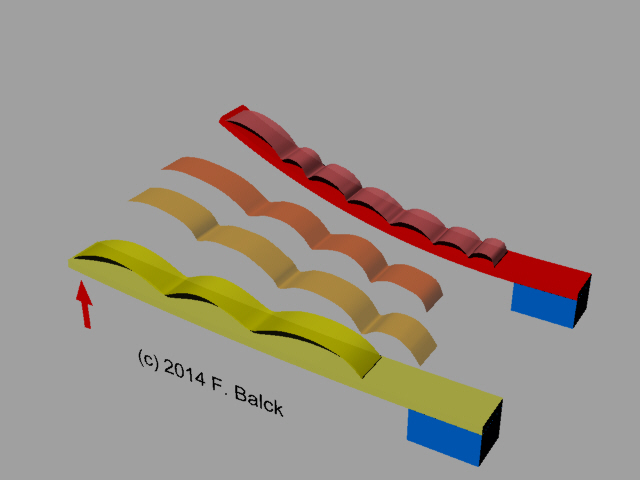 |
Abb. 04-04-01-03: Mit zunehmender
Biegespannung steigt die Anzahl der Zonen an.aus kuehlwasser-zwanzig.htm#kapitel-02-01 |
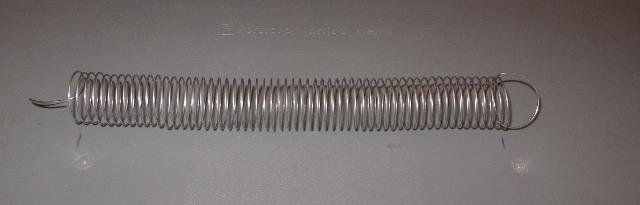 |
Abb. 04-04-01-04: Spiralfederaus kuehlwasser-zwanzig.htm#kapitel-02-02 |
 |
Abb. 04-04-01-05: Slinky, Spiralfeder
mit flachem Draht. aus bbewegte-materie.htm#kapitel-04-04 |
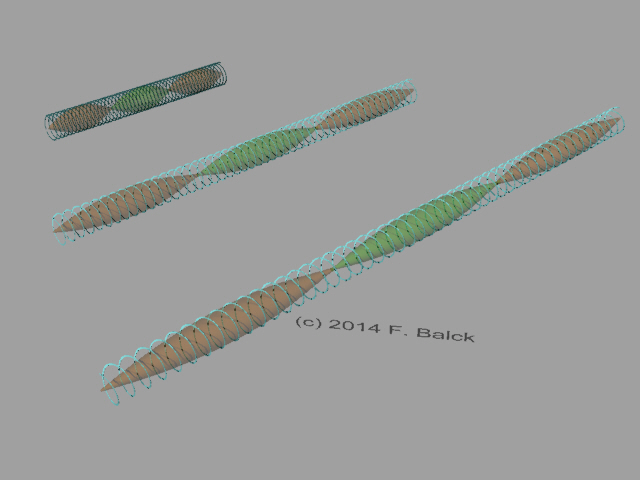 |
Abb. 04-04-01-06: Zonen im Innenraum
bei einer Spiralfeder. Mit zunehmender Spannung
wächst die Anzahl der Zonen.
|
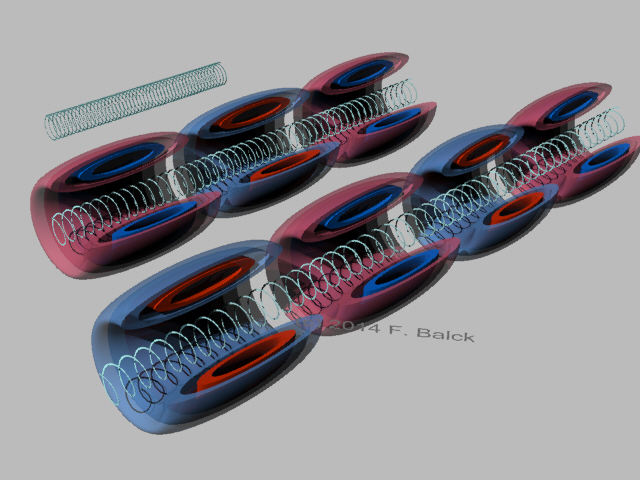 |
Abb. 04-04-01-07: auch im Außenraum
gibt es torusartige Strukturen, deren Anzahl mit der
Spannung wächst.aus kuehlwasser-zwanzig.htm#kapitel-02-02 |
 |
| Abb. 04-04-01-08: Eine Druckflasche
für den Gartenbedarf ist mit einem Drucksensor
verbunden. A pressure bottle for gardening needs is connected to a pressure sensor. (FB) |
 |
| Abb. 04-04-01-09: Es wird die
Ausdehnung des Orbitals in Richtung Norden als
Funktion des Drucks gemessen. The expansion of the orbital in the north direction is measured as a function of pressure. (FB) |
 |
| Abb. 04-04-01-10: Radius des Orbitals
als Funktion des Drucks in der Flasche. Steigung 22 m/bar Radius of the orbital as a function of the pressure in the bottle. (FB) |
26.11.2024
Temperatur 9°, blaue Flasche, Füllung 1000 ml Wasser, 640 ml Luft, Orbital in Richtung West
 |
| Abb. 04-04-01-11:
Blutdruck-Meßgerät, Anzeige in mmHg (FB) |
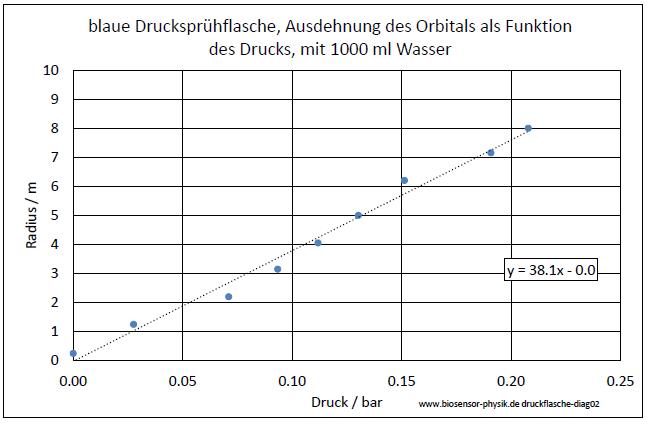 |
| Abb. 04-04-01-12: Das Orbital
wächst mit dem Luftdruck in der Flasche, Steigung
38 m /bar |
4.4.1.1 Vergleich mit einem hängenden Stab
Als Belastung: ein Eimer mit Konservendosen
 |
| Abb. 04-04-01-01-02: Die spürbare
Struktur umgibt den Stab wie ein Zylinder mit
gleicher Achse. Sie erstreckt sich nach links und rechts gleichermaßen (jeweils etwa 25 cm). (FB) |
 |
| Abb. 04-04-01-01-02: In dem Eimer
standen 0 bis 5 Konservendosen. (FB) |
 |
| Abb. 04-04-01-01-03: Der
Zollstock gibt die Richtung der Messung an. (FB) |
 |
| Abb. 04-04-01-01-04: Ausdehnung einer
Struktur bei einem hängenden Stab mit
unterschiedlicher Last. Je größer die Last, umso
größer der Radius der Struktur. (FB) |
4.4.1.2 Vergleich mit Belastung einer Spiralfeder (Federwaage)
 |
| Abb. 04-04-01-02-01: Oben ist die
Zugfeder aufgehängt, nach rechts dient ein Zollstock
als Maßstab für die Ausdehnung der Struktur, unten
wird in den Meßbecher jeweils eine Portion Wasser
dazugegeben (30g) (FB) |
 |
| Abb. 04-04-01-02-02: Zollstock und
Federwaage (fB) |
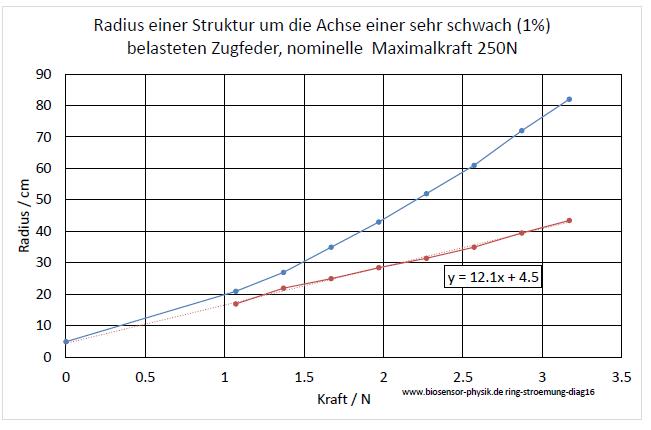 |
| Abb. 04-04-01-02-03: Mit zunehmender
Last wächst der Radius der Struktur an. blaue Kurve: Vorversuch, rote Kurve: nach jedem Lastwechsel wurde bis zum Ablesen jeweils zwei Minuten gewartet. Ergebnis:
|
4.4.1.2a Struktur bei einer Kugelschreiberfeder unter veränderter Belastung
 |
| Abb. 04-04-01-02a-01: Vier
Kugelschreiber wurden mit 45° Winkelmarkierungen
versehen. Eine Umdrehung entspricht etwa 28 mm. (FB) |
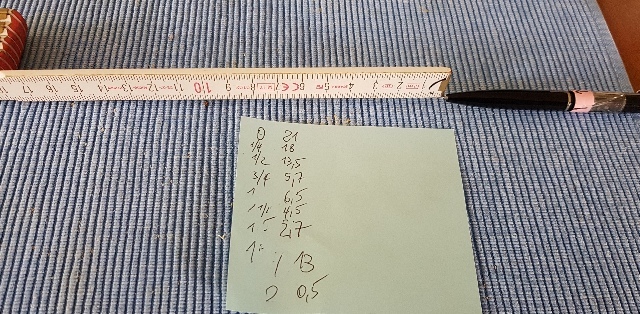 |
| Abb. 04-04-01-02a-02: Die Länge der
Struktur an der Spitze der Mine gegen die Anzahl der
Viertelumdrehungen. (FB) |
 |
| Abb. 04-04-01-02a-03: Das Gewinde der
Verschraubung hat eine Steigung von etwa 0.9
mm (FB) |
 |
| 04-04-01-02a-4: Nach etwa zwei
Umdrehungen ist die Feder entspannt (und die
Gewindeverbindung ist gelöst). Die Struktur ist von
20 cm nahezu auf Null geschrumpft. (FB) |
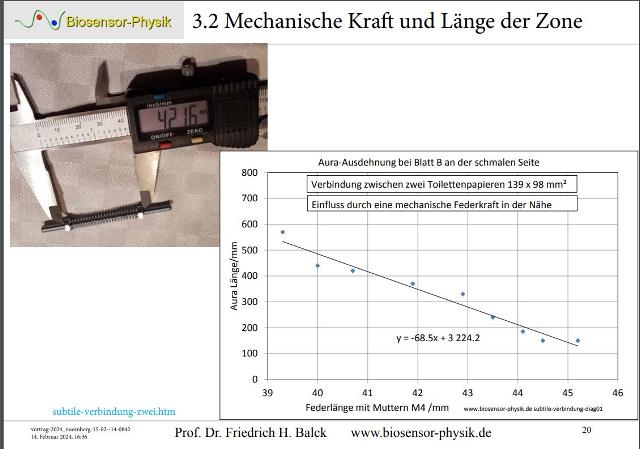 |
04-04-01-02a-05:Länge der spürbaren
Struktur schrumpft mit Entlastung der Federaus vortrag-2024-nuernberg-15-02.pdf |
4.4.1.3 Latente Wärme in Flüssigkeit gespeichert, Kalt-Warm-Kompressen
In kleinen Plastikbeuteln befindet ein Medium, das als Flüssigkeit bzw. auskristallisiert vorliegt.
Erwärmt man den Beutel in kochendem Wasser einige Zeit, dann schmelzen alle Kristalle auf und man bekommt nur die Flüssigkeit.
Läßt man den heißen Beutel dann langsam abkühlen, bleibt der Inhalt flüssig, ohne zu kristallisieren. "Die Flüssigkeit ist unterkühlt."
Löst man nach dem Abkühlen mit dem im Beutel eingeschlossenen "Knackfrosch" eine Schockwelle aus, erstarrt das Material innerhalb von rund 20 Sekunden. Dabei wird die zuvor hineingegebene Schmelzwärme wieder frei und erwärmt den Beutelinhalt.
Die ist gewünscht z.B. für eine medizinische Wärmebehandlung.
Die in der Unterkühlung "schlummernde" Energie zeigt sich in einer Erweiterung der Aura des Beutels.
Und zwar wächst die Aura mit zunehmendem Abstand zwischen Beuteltemperatur und Schmelztemperatur (kochendes Wasser).
Bei mehreren Beuteln mit unterschiedlicher Temperatur läßt sich über die Länge der Aura herausfinden, welcher Beutel der wärmere ist.
 |
| Abb. 04-04-01-03-01: Der Inhalt ist
auskristallisiert, Blick auf den "Knackfrosch"
(FB) |
 |
| Abb. 04-04-01-03-02: Der Inhalt ist
flüssig. (FB) |
 |
| Abb. 04-04-01-03-03: Wenige Sekunden
nach dem "Knack" 18:44:06 (FB) |
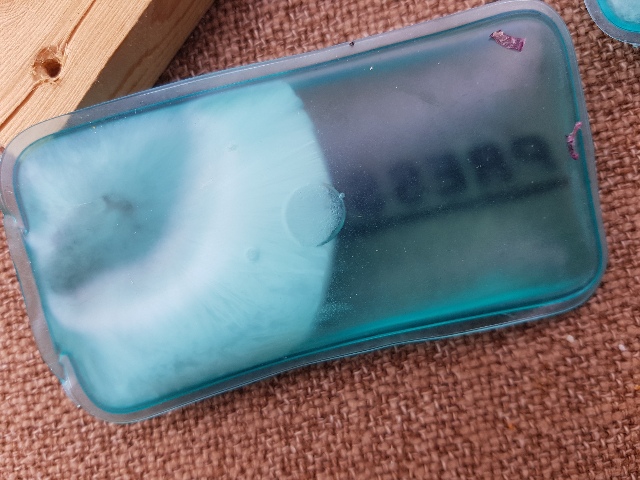 |
| Abb. 04-04-01-03-04: 18:44:10
vier Sekunden später (FB) |
 |
| Abb. 04-04-01-03-05: 18:44:17
elf Sekunden später (FB) |
 |
| Abb. 04-04-01-03-06: 18:44:22
sechzehn Sekunden später (FB) |
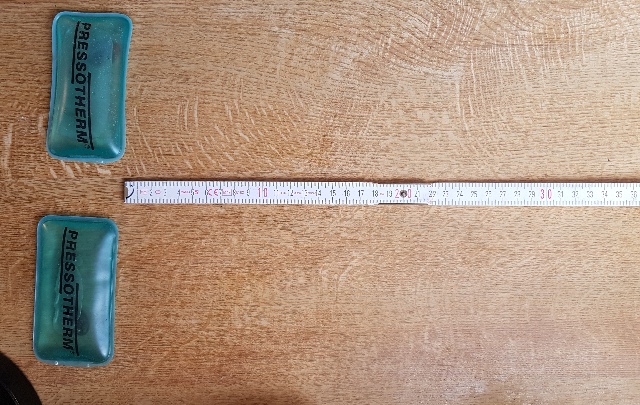 |
| Abb. 04-04-01-03-07: Länge der
Aura beim oberen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx und unteren Beutel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (FB) |
 |
| Abb. 04-04-01-03-08: der obere Beutel
ist wärmer, (55.6°) der untere kälter (39.9°)
(FB) |
  |
| Abb. 04-04-01-03-09:
Temperaturmessung,
unterschiedliche Farbskalen! (FB) |
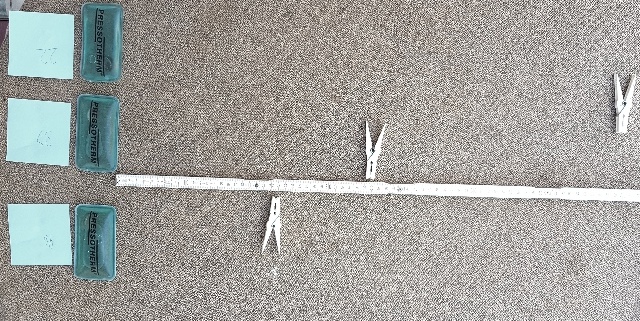 |
| Abb. 04-04-01-03-10: Länge der
Aura bei unterschiedlichen
Temperaturen unten: 46° 22 cm mitte: 37° 35 cm oben: 22° 70 cm Die Flüssigkeit im abgekühlten Kissen hat die größte gespeicherte Energie (mechanische Spannung) die im vergleichsweise wärmste Kissen hat die kleinste Energie gespeichert. (FB) |
4.4.2 Orbital von einem Bleiklotz als Detektor
- Der Radius des Orbitals vergrößert sich bei Anregung (in Ruhe ca. 0,5 m bei Anregung > 2m).
- Über die Zunahme beim Radius läßt sich die Stärke der Anregung messen.
4.4.2.1 Einfluß einer elektrischen Spannung, Seebeck-Effekt
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abb. 04-04-02-01: Ein Bleiklotz (2397
g) (Hartblei mit einigen % Antimon)
liegt hinten auf dem Tisch. Das Orbital des Klotzes hat einen Radius von ungefähr 0,5 m. Legt man zwischen den beiden Klemmen im Vordergrund eine Gleichspannung von rund 10 µV aus der USB-Spannungsquelle (Abb. 04-03-04), dann wächst das Orbital auf über 2 m an. Die Polarität der Spannung spielt dabei keine Rolle. Das Anwachsen nimmt etwas Zeit in Anspruch. Die Geschwindigkeit bei der Zunahme hängt davon ab, wie weit die Klemmen vom anfänglichen Orbitaldurchmesser entfernt sind. Bei über einem Meter Abstand dauert es etwa ein bis drei Sekunden, bis der Endzustand erreicht ist. (FB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abb. 04-04-02-02: Die rote Klemme
liegt innerhalb vom Orbital. Das Anwachsen des
Orbitals bei Anlegen einer Spannung geht spontan,
d.h. ohne Zeitverzögerung. (FB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abb. 04-04-02-03: Statt der Spannung
aus der USB-Gleichstromquelle, stammt nun die
Spannung von diesem Thermospannungs-Set. Zwei
Wassergläser mit etwa 1° Unterschied
liefern rund 12.5 µV, die zu den Klemmen
geleitet werden. Auch mit dieser Thermospannung läßt
sich das Orbital vom Bleiklotz entsprechend
erweitern. (FB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abb. 04-04-02-04: Das verwendete
Thermoelement hat zwei Kontaktstellen, links
Eisendraht, rechts Kupferdraht (FB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abb. 04-04-02-05: Eine Kontaktstelle
aus Eisen und Kupfer, Thermospannung 12.5 µV /
K (FB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abb. 04-04-02-06:
blaue Kurve: Thermospannung
(Seebeck-Koeffizient) Die Zahlen beziehen sich auf den Abstand zum Element Platin Es gibt Elemente mit positivem und auch mit negativem Koeffizienten.
Beispiel: Für das Thermopaar Kupfer Eisen ergeben sich (19 - 6.5 = 12.5) 12.5 uV/K aus wuest-wimmer.htm |
 |
| Abb. 04-04-02-07: Verschiedene Bleche
aus Metall: Kupfer, Aluminium, Eisen, NIckel, Zink, Titan, Tantal, Wolfram Immer wenn sich zwei Bleche berühren, gibt es spürbare Strukturen, die je nach Metall unterschiedliche Qualitäten und Intensitäten haben. Wichtig ist bei den Versuchen, daß nach dem Übereinanderlegen keine Biegespannungen auftreten, weil eine mechanische Spannung von sich aus schon spürbare Strukturen erzeugen. (FB) |
Feinstoffliche Orbitale beim Seebeck-Effekt
 |
| Abb. 04-04-02-08:
NiCr-Ni-Thermoelement, normalerweise befindet sich
der gelbe Stecker in der Buchse vom Meßgerät, jetzt
wird über die Krokodilklemmen eine kleine
Spannung eingespeist. (FB) |
 |
| Abb. 04-04-02-09: NiCr-Ni-
Thermoelement, Zollstock zeigt nach Osten (FB) |
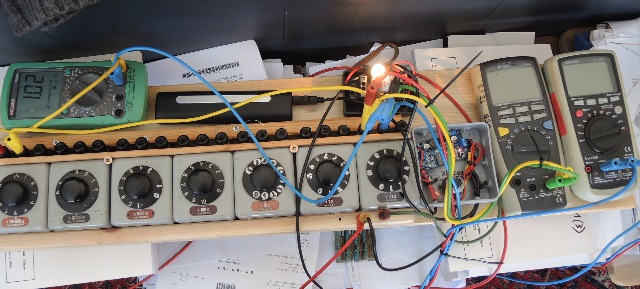 |
| Abb. 04-04-02-10: Der Strom fließt über das rechte Amperemeter. Der Meßbereich für Strom ist in diesem Moment nicht aktiviert, daher ist dort kein niederohmiger Durchgang, sondern ein Widerstand von 1 MOhm zwischen den Klemmen. (FB) |
 |
| Abb. 04-04-02-11: Thermoelement,
Kupferdraht mit Eisendraht verlötet (FB) |
 |
| Abb. 04-04-02-12: Eisendraht und
isolierter Kupferdraht, am Ende verlötet. Zollstock
zeigt nach Osten (FB) |
 |
| Abb. 04-04-02-13: oben NiCr-Ni
40 µV / K Edelstahl-Ummantelung, Isolierung
mit Magnesium-Oxid) und unten Eisen-Kupfer (FB) |
 |
| Abb. 04-04-02-14: Peltier-Element mit
16x16 Elementen, der Zollstock zeigt nach Osten.
(FB) |
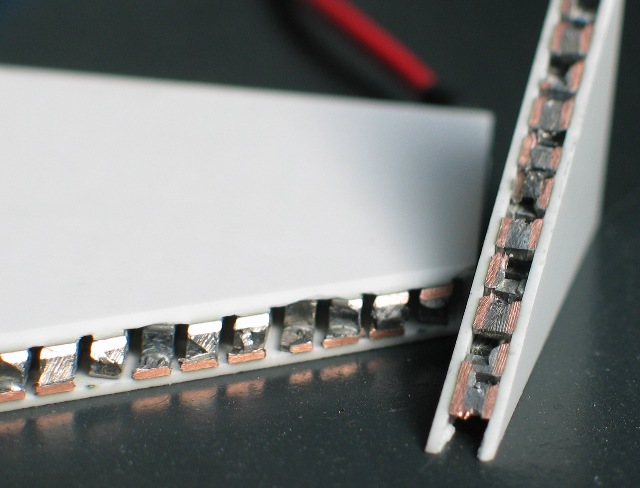 |
Abb. 04-04-02-15:
aus felder.htm#kapitel-04-04 |
 |
| Abb. 04-04-02-16: Legt man an ein
Thermoelement eine kleine Gleichspannung, dann gibt
es um den Kontaktpunkt herum eine spürbare Struktur
in Form eines Orbitals. Der Radius des Orbitals nimmt mit der angelegten Spannung zu. Diese stammte aus einem Spannungsteiler mit den Stufen 1 bis 10 x 100 000 Om zu 0,1 Ohm. Die Speisespannung am Teiler war 1 V bzw. bei dem 16x16 Peltier-Elementen (eine Hintereinanderschaltung von 256 Einzelelementen) 11.7 mV; 5.7 mV; 5.5 mV. Um sie in dieser Darstellung mit den anderen Einzel-Elementen vergleichen zu können, wurden die tatsächlichen Spannungen mit dem Faktor 256 multipliziert. (FB) |
 |
| Abb. 04-04-02-17: Unter der Annahme,
daß es sich um ein kugelförmiges Orbital handelt,
wurde mit dem gemessenen Radius das Volumen
berechnet. Es sieht so aus, daß das Volumen bei genügend hohen Spannungen linear mit der Spannung anwächst. (FB) |
4.4.2.2 Einfluß einer mechanischen Spannung
Meßgröße: Radius des Orbitals von einem Bleiklotz
 |
| Abb. 04-04-02-017: Bleiklotz (Hartblei
mit einigen % Antimon) und Eisenstab 8 mm
Durchmesser. Hält man ihn horizontal an einem Ende,
verbiegt er sich etwas wegen seines Eigengewichtes.
Die dabei entstehenden spürbaren Strukturen lösen
beim Bleiklotz eine vergleichbare Vergrößerung des
Orbitals (Radius von ca. 0,5 m auf über 2 m) aus wie
bei Anlegen der elektrischen Spannung. (FB) |
Anregung von anderen Objekten mit einer mechanischen Spannung.
Meßgröße: Radius des Orbitals
von Kerze, Aluminiumscheibe, Messingzylinder, Eisenkugel, Glaskugel, Marmorstein
Für alle gilt: Mit Hilfe von einer kleinen elektrischen Spannung zwischen den Klemmen bzw. mit dem Einfluß der mechanischen Spannung eines schwach durchgebogenen Eisenstabes wächst das Orbital um ein Vielfaches an.
 |
| Abb. 04-04-02-18: Kerze aus Paraffin.
Wenn sie brennt, gibt es eine große Struktur (FB) |
 |
| Abb. 04-04-02-19: Verschiedene
Objekte: Kerze, Aluminiumscheibe, Messingzylinder, Eisenzylinder, Eisenkugel, Glaskugel, Marmorstein (FB) |
4.4.3 Einfluß von Erwärmung
4.4.3.1 Orbital vom Bleiklotz als Detektor für Anregungen
 |
| Abb. 04-04-03-01: Der Messingstab
zeigt mit dem linken Ende in Richtung Bleiklotz (Hartblei
mit einigen % Antimon). Er wird am rechten Ende für wenige Sekunden mit der Flamme erwärmt. Anschließend vergrößert sich das Orbital vom Bleiklotz für kurze Zeit (10 -20 Sekunden) und schrumpft dann wieder auf den Anfangswert. (FB) |
4.4.3.2 Wirbelzonen als Detektor für Strömungen
Strömungen z.B. in einem Rohr sind von feinstofflichen Strukturen umgeben. (Abb. 04-02-12)
Diese Strukturen wechselwirken mit Objekten, die in der Nähe der Strömung sind.
Insbesondere führen geschlossene Ringe, durch die die Strömung führt, zu starken Effekten: Wirbelzonen.
 |
Abb. 04-04-03-02: Bei Strömungen z.B.
von Wasser, Luft, Strom und Licht gibt es im
Außenraum feinstoffliche Strukturen.
Unterlegscheiben oder andere ringförmige Objekte
wirken als Hindernisse und führen zur Ausbildung von
Wirbelzonen. aus wasser-ader-zwei.htm#kapitel-04 |
 |
| Abb. 04-04-03-03: Der Holzlöffel wird
durch das stehende Wasser bewegt. Vor dem Löffel entsteht ein "Überdruck", d.h. es ist dort ein Berg, dessen Wasser zu beiden Seiten hin abfließt. Dabei entstehen Wirbel. Hinter dem Löffel entsteht ein "Unterdruck". Dorthin bewegen sich die Wirbel. aus bewegte-materie-oszillierend.htm#kapitel-10-01 |
 |
| Abb. 04-04-03-04: Ein Schiff auf dem
Rhein-Main-Donau-Kanal. Während der Vorbeifahrt strömt Wasser im Uferbereich in der anderen Richtung. (FB) |
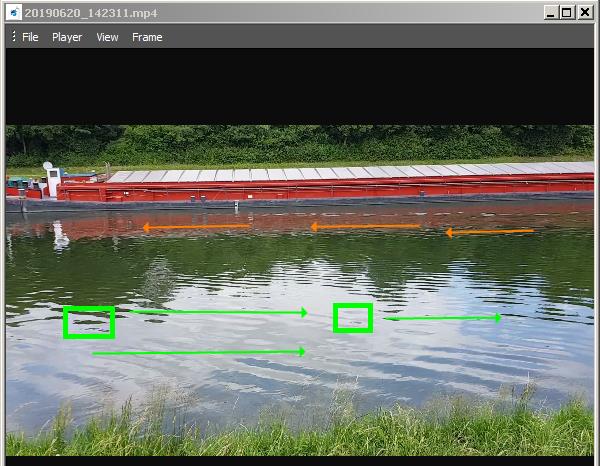 |
Abb. 04-04-03-05: Das Schiff bewegt
sich nach links, das Wasser im vorderen Bereich
(grün) nach rechts. aus stroemung-wirbel.htm (FB) |
 |
| Abb. 04-04-03-06: Ein Dichtungsring
ist in der Mitte vom Messingstab angebracht. Rechts
steht der Lötbrenner mit offener Flamme. (FB) |
 |
| Abb. 04-04-03-07: Wird der
Messingstab am rechten Ende für wenige Sekunden
erhitzt, bilden sich Wirbelzonen um dem Stab herum,
wie man sie bei Strömungen von Wasser, Luft, Strom,
Licht findet. Diese Zonen verschwinden wieder nach
einigen Sekunden. Dann ist offensichtlich die durch
die Erwärmung mit der Flamme angeregte Strömung
wieder zur Ruhe gekommen. (10). |
 |
| Abb. 04-04-03-08: Ein Stück
Silikonschlauch anstatt Dichtring auf dem
Messingstab. Auch hierbei gibt es Wirbelzonen, wenn
man den Stab am rechten Ende kurzzeitig erwärmt.
(FB) |
4.4.4 Einfluß einer sehr kleinen Gleichspannung bei einem Stab (ohne elektrischen Kontakt)
Sowohl bei einem Stab aus elektrisch leitenden als auch bei einem nichtleitenden Material läßt sich eine "Strömung" beobachten, wenn zwischen beiden Enden eine Spannung anliegt. Dabei fließt im klassischen Sinne kein elektrischer Strom!
Nach Einschalten der Spannung ist der Stab von spürbaren Strukturen mit einem Radius von etwa 10 cm umgeben.
Bringt man ein Hindernis (geschlossener Ring) etwa in der Mitte des Stabes an, dann bildet sich dort eine Wirbelzone mit Radius von einigen Dezimetern, wenn Ring und Stab komplementäre Eigenschaften bezüglich elektrischer Leitfähigkeit haben..
Bei einem Holzstab mit einem Holzring, bzw. bei einem Messingstab mit einem Ring aus Kupfer bilden sich diese Wirbelzonen nicht aus.
 |
| Abb. 04-04-04-01: Weißer Plastikstab
mit zwei Krokodilklemmen, an denen die Spannung
anliegt. (FB) |
 |
| Abb. 04-04-04-02: Plexiglasstab, die
rote Klemme liegt nur lose auf (FB) |
 |
| Abb. 04-04-04-03: Kupferstab, er
liegt links nur lose auf der schwarzen Klemme (FB) |
 |
| Abb. 04-04-04-04: Messingstab 8 mm,
liegt lose auf den isolierten Krokodilklemmen aus. In der Mitte befindet sich ein Dichtring aus Kunststoff. Liegt an den Klemmen eine kleine Gleichspannung, dann gibt es längs des Stabe spürbare Strukturen. Im Bereich des Ringes findet man eine große Wirbelzone. (FB) |
 |
| Abb. 04-04-04-05: Umgekehrte
Anordnung: Stab aus geriffeltem
Buchenholz und Ring aus Kupferdraht. Auch hier
findet man eine Wirbelzone beim Ring, wenn eine
Spannung angelegt ist. (FB) |
 |
| Abb. 04-04-04-06: Buchenstab und Ring
aus Kupferdraht. (FB) |
 |
| Abb. 04-04-04-07: USB-Spannungsquelle,
links das grüne Meßgerät für die Eingangsspannung am
Spannungsteiler, 0,25 V an 10 000 Ohm
: 0,1 Ohm 250 mV / 100 000 = 2,5 µV
(FB) |
 |
| Abb. 04-04-04-08: Bleiklotz als
Detektor (Hartblei mit einigen % Antimon) Das Orbital vom Bleiklotz vergrößert sich, wenn der Buchenstab unter elektrischer Spannung steht. (FB) |
4.4.5 Strömungen bei mechanischen Spannungen
 |
| Abb. 04-04-05-01: Ein Stahldraht 0,5
mm Durchmesser ist oben befestigt. Unten hängt ein
Gewicht, das mit einer Kraft von rund 30 N nach
unten zieht. Bringt man einen Dichtungsring an die Stelle in der Mitte, dann kann man eine Wirbelzone (wie ein Torus) beobachten. Daraus folgt, daß es eine Strömung geben muß. (FB) |
 |
| Abb. 04-04-05-02: Das Gewicht:
Gripzange und Bleiklotz (FB) |
4.4.6 Strömung bei einem aktiven Körper
Mit der Bewegung eines leitfähigen Rings läßt sich bei nichtleitenden Stäben zeigen, daß es eine Strömung im Außenraum gibt, die von der Ausrichtung des Materials bei der Herstellung kommt. (Ziehrichtung)
 |
| Abb. 04-04-06-01: Analog zum aktiven
Körper: hier strömt Wasser und erzeugt eine
Wirbelstruktur. Kapillare mit 1 mm Innendurchmesser. Wenn mit dem Kolbenprober von links Wasser hindurchgedrückt wird, erzeugt die Wasserströmung im Außenraum vom Dichtring eine spürbare Wirbelstruktur. (FB) |
 |
| Abb. 04-04-06-02: Kapillare und
Dichtring (FB) |
 |
| Abb. 04-04-06-03: Zwei
Plastikstäbe nebeneinander, gleiche
Ausrichtung bezüglich der Ziehrichtung Bewegt man die Kupferspule in Achsenrichtung entsteht eine mitlaufende Wirbelzone = > es gibt ein Strömung im Außenraum der Stäbe. (FB) |
 |
| Abb. 04-04-06-04: Beide Plastikstäbe
mit entgegengesetzter Richtung. Beim Bewegen der Kupferspule gibt es nun keine Wirbelzone. (FB) |
5. Sonstiges-2
5.1 Festkörpereigenschaften
Austrittsarbeit.
Widerstand ist temperaturabhängig.
Einige physikalische Größen sind temperaturabhängig.
Beispielsweise ist dies die Länge oder der elektrische Widerstand eines Festkörpers.
Bei Flüssigkeiten vergrößert sich das Volumen,
und auch bei Gasen nimmt das Volumen bzw. der Druck mit der Temperatur zu.
 |
| Abb. 05-01-01: Beim Festkörper
nimmt in der Regel der elektrische Widerstand mit
der Temperatur zu. Bei einigen Materialien gibt es einen fast linearen Zusammenhang über einen weiten Temperaturberich, wie hier bei Platin. Daraus lassen sich elektrische Thermometer anfertigen. Der PT-100 Widerstand hat genau 100 Ohm bei 0°. (FB) |
 |
| ABb. 05-01-02: Bei verunreinigten
Metallen oder Legierungen besteht der elektrische
Widerstand aus mehreren Anteilen, davon ist einer
nahezu temperaturunabhängig. Beim Abkühlen bis zu
tiefen Temperaturen (z.B. 4,2 K) bleibt dieser
Anteil als Restwiderstand übrig. Das Restwiderstandsverhältnis (RRR) gibt an, um welchen Faktor sich der Widerstand zwischen Zimmertemperatur und Temperatur des flüssigen Heliums verringert. Ein hoher Wert spricht für eine gute Anordnung der Atome und Reinheit des Festkörpers, ein niedriger Wert für Unordnung bzw. Gemisch (Legierung) aus unterschiedlichen Atomen oder Verunreinigungen. Beispiel: Legierung aus Kupfer und Zink (gamma-Messing) nach unterschiedlichen Wärmebehandlungen. Durch entsprechendes "Glühen", läßt sich das RRR von etwa 2,1 bis auf 3,0 verbessern. (Seite 69, FB-Dissertation) |
 |
| Abb. 05-01-03: Gitterkonstante
(Abstand der Atome) und Länge nehmen mit steigender
Temperatur zu. Dicht unterhalb vom Schmelzpunkt dehnt sich der Körper stärker aus als es der Zunahme der Atomabstände entsprechen würde. Es bauen sich Fehlstellen bzw. Lücken ein . (Seite 26 FB-Dissertation) |
 |
| Abb. 05-01-04: Längenänderung von
einem Stahlstab (Baustahl) bei unterschiedlichen
Temperaturen, (gerechnet, Abhängigkeit vereinfacht
durch Annahme von einem konstanten
Ausdehnungskoeffizient von 12 E-6 / K, Start
der Kurve bei 50 K und der Länge 1 ) Temperarturunterschied von 100 K entspricht 100 * 12 E-6 = 1,2 E-3 oder 0,12 % (FB) |
 |
| Abb. 05-01-05: Längenänderung von
einem Stahldraht bei unterschiedlicher Zugkraft
(gerechnet) Elastizitätskoeffizient 210 GPa Zugkraft 130 N / 0.5 E-6 m², Spannung 260 E-6 N/m² (Pa=N/m²), 210 GPa => 260 E-6/210 E-9 = 0.0012 oder 0,12% Fazit: eine Temperaturänderung von 100 K erzeugt bei diesem Draht mit 0,5 mm² Querschnitt die gleiche Längenänderung wie eine Zugkraft von 130 N. (FB) |
5.2 Eisenbahnschienen als Thermometer (1)
Die Ausdehnung der spürbaren Zone über den Schiene ist ein Maß für die mechanische Spannung und somit auch für die Temperatur des Materials.
Mit zunehmendem Abstand zur Schienentemperatur während der Schweißung - die mechanische Spannung war da Null - wächst die Höhe der spürbare Zone an.
Optimale Schweißtemperatur: 20° - 26°
Video Zeitmarke 28:45 https://www.youtube.com/watch?v=0nTRjt4IfKg
"im Bereich der Deutschen Bahn AG Schienen in einem Temperaturbereich von 20 bis 26 °C verschweißt".
https://de.wikipedia.org/wiki/Schienensto%C3%9F
 |
| Abb. 05-02-01: Eisenbahnschienen
werden geschweißt. Man stellt die Naht durch
Ausfüllen des Spaltes mit flüssigem Stahl
(Thermitverfahren) her. Bild einige Tage nach dem Schweißen, die Schleifspuren zeigen die Nachbearbeitung. Die Schweißnaht muß sehr hohe Kräfte aushalten, die bei großen Temperaturänderungen auftreten. Mögliche Temperaturen im Sommer bei über 40° (direkte Sonneneinstrahlung), im Winter bei -20° . (FB) |
 |
| Abb. 05-02-02: Schweißnähte einige
Jahre alt (FB) |
 |
| Abb. 05-02-03: Es gibt oberhalb der
beiden Schienen in Längsrichtung jeweils eine
ausgedehnte spürbare Zone, die wie eine Schicht auf
dem Gleisbett liegt. Sie ist gut von der Seite zu
"sehen". schematisch: rot für das vordere und grün für das hintere Gleis. Foto bei Temperatur ca. 5°, Höhe der Zonen über den Schienen etwa 0,4 m (2,5 Schienenhöhen) (FB) |
 |
| Abb. 05-02-03a: Zwei gut hörbare
Schweistellen nördlich von Eschenau. Wenn der Zug bei der grünen als auch bei der roten Markierung fährt, hört man bei jeder Achse laute Schläge, wenn die Räder darüber rollen. https://opentopomap.org/#map=17/49.58042/11.20646 |
 |
| Abb. 05-02-03b: bei der roten
Markierung: westliches Gleis, Außenseite Schlechte Oberflächenbearbeitung, daher Schlaggeräusche Wenn ein Zug darüber fährt, sinkt die Schiene einschließlich der benachbarten Stahlschwellen bei jeder Achse etwa 1 cm (sichtbar) nach unten. Die Schläge haben offensichtlich das Schotterbett verdichtet. Es droht vorzeitiger Verschleiß! (FB) |
 |
| Abb. 05-02-03c: bei der roten
Markierung: westliches Gleis, Innenseite Schlechte Oberflächenbearbeitung, daher Schlaggeräusche (FB) |
 ???? ???? |
| Abb. 05-02-03d: bei der roten
Markierung: östliches Gleis, Außenseite Schlechte Oberflächenbearbeitung, daher Schlaggeräusche (FB) |
 |
| Abb. 05-02-03e: bei der roten Markierung: östliches Gleis, Außenseite (FB) |
 |
| Abb. 05-02-03f: bei der grünen
Markierung: (FB) |
 |
| Abb. 05-02-03g: bei der grünen Markierung: etwa 1 mm Vertiefung (FB) |
 |
| Abb. 05-02-03h: bei der grünen
Markierung: etwa 1 mm Vertiefung (FB) |
 |
| Abb. 05-02-04: Bahnhof Rüsselbach, an
der B2 https://opentopomap.org/#map=16/49.60847/11.23440 |
 |
| Abb. 05-02-05: 10.2.2021, 12:54
Bei Temperatur von etwa -5° (Autothermometer), Höhe der spürbaren Zonen über der Schiene: ca. 1 m (FB) |
 |
| Abb. 05-02-06: 15.02.2021,
08:52 Uhr Höhe der Zonen etwa 1,6 m (gemessen mit Zollstock), Temperatur gemessen neben der Schiene: -7,4° (FB) |
 |
| Abb. 05-02-07: Das Thermoelement
liegt direkt am Fuß der Schiene, dort Anzeige -7,4°
(FB) |
 |
| Abb. 05-02-08 16.02.2021, 10:33 Uhr Temperatur gemessen neben der Schiene -0.7°, gemessene Höhe 80 cm (FB) |
 |
| Abb. 05-02-09 17.02.2021, 14:59
Uhr, gemessene Höhe 60 cm, etwa 6°
(FB) |
 |
| Abb. 05-02-10: 18.02.2021 14:03 Uhr gemessene Höhe 25 cm, Temperatur unter dem Schienenfuß 13,7° (FB) |
 |
| Abb. 05-02-11: 19.02.21
09:44 Temperatur 5.1°, Höhe 52 cm (FB) |
 |
| Abb. 05-02-12:
19.02.21 13:17 12.3°
30 cm (FB) |
 |
| Abb. 05-02-13: 20.02.21 14:30 |
 |
| Abb. 05-02-14:
20.02.21 14:32 23.8°,
5 cm (FB) |
 |
| Abb. 05-02-15: 21.02.2021
13:06 21.8°, 6 cm (FB) |
 |
| Abb. 05-02-16: 23.02.2021 13:30
20.7°, 4 cm (FB) |
 |
| Abb. 05-02-17: 24.02.21 14:22
26°, 11 cm (FB) |
 |
| Abb. 05-02-18: 25.02.21
14:27 18°, 5 cm
(FB) |
 |
| Abb. 05-02-19: 09.05.2021
14:15 38.5°, 85 cm
(FB) |
Verbindung Forchheim Ebermannstadt
 |
| Abb. 05-02-20: Bahnhof Ebermannstadt,
Richtung Osten, Museumsbahn (FB) |
 |
| Abb. 05-02-21: Bahnhof Ebermannstadt,
Prellbock, Gleis in Richtung Forchheim (FB) |
 |
| Abb. 05-02-22: Bahnhof Ebermannstadt, vom Prellbock aus gesehen, Gleis in Richtung Forchheim (FB) |
 |
| Abb. 05-02-23: Bahnhof Ebermannstadt, vom Prellbock aus gesehen, Gleis in Richtung Forchheim (FB) |
 |
| Abb. 05-02-24: Bahnhof Ebermannstadt,
Nähe Prellbock, Gleis in Richtung Forchheim Prägestempel: BVG 1961 S49 (Bochumer Verein) Temperatur 6,5°, gemessene Höhe 10 cm (FB) |
 |
| Abb. 05-02-25: Bahnhof Kirchehrenbach
(FB) |
 |
| Abb. 05-02-26: Kirchehrenbach,
Isolierstück, trennt beide Hälften elektrisch (FB) |
 |
| Abb. 05-02-27: Bahnhof
Kirchehrenbach, Temperatur 4°, gemessene
Höhe 45 cm (FB) |
 |
| Abb. 05-02-28: Bahnhof Wiesenthau, Temperatur: 6,2°, gemessene Höhe 50 cm (FB) |
 |
| ABb. 05-02-29: rechts Bahnhof
Wiesenthau, gemessene Höhe 55 cm Temperatur wie
vorher. (FB) |
 |
| Abb. 05-02-30: Bahnhof
Gosberg (FB) |
 |
| Abb. 05-02-31: Bahnhof Gosberg,
gemessene Höhe 60 cm, Temperatur 6,0° (FB) |
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abb. 05-02-89: Daten vom Bahnübergang
am Bahnhof Rüsselbach sowie Ergänzungen an der Strecke Forchheim Ebermannstadt Linke Achse: gemessene Höhe gegen gemessene Temperatur (ausgefüllte Raute, rotes Quadrat) rechte Achse: Temperaturdifferenz zu 22 ° (vermutete Schweißtemperatur) Bei den Daten von Rüsselbach nimmt die Höhe der Struktur über den Schienen zu, je weiter die aktuelle Temperatur von 22° entfernt ist. Vermutlich war dies die Temperatur beim Schweißvorgang, d.h. die Schiene war zu der Zeit spannungsfrei. Bei Temperaturen oberhalb davon treten durch die Wärmeausdehnung im Material Spannungen auf, die die Schiene zusammendrücken, unterhalb davon auseinandergeziehen. Die Hilfslinie mit den roten Punkten ergibt sich, wenn man den Betrag der Differenztemperatur zwischen tatsächlicher und vermuteter Schweißtemperatur gegenüber der Temperatur aufträgt. Die leichte Verschiebung der gemessenen Werte nach außen zeigt, daß selbst bei der Schweißtemperatur noch eine Resthöhe von einigen Zentimetern übrig bleibt. (FB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3 Eisenbahnschienen als Thermometer (2), Beobachtungen an Fotos von Schienen,
Jeffrey Keen beschreibt die Möglichkeit, Information aus Fotos zu bekommen.
/keen 2018/ Chapter 13 Photographing Subtle Energies
remote-viewing.htm
Mit dieser Methode kann man die spürbaren Strukturen über den Gleisen auch lange Zeit später ermitteln.
Hier sind einige Beispiele:
 |
||||||||||||||||||||||||
| Abb. 05-03-01: Die letzten Meter bis
zum Prellbock, fast keine mechanische Spannung Bahnhof Lauterbach, drei Schienen, Rasender Roland auf der Insel Rügen (FB) |
||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||
| Abb. 05-03-02: Prellbock, Schienen
nicht unter Spannung, Eisenbahnmuseum Nürnberg |
||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||
| Abb. 05-03-03: Schienen nicht unter
mechanischer Spannung, Gleisbauarbeiten Kersbach, Baiersdorf (FB) |
||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||
| Abb. 05-03-04: das Gleis im Hintergrund ist unter mechanischer Spannung, das in der Mitte nur wenig und die einzelnen Schienen im Vordergrund sind spannungsfrei, Gleisbauarbeiten Kersbach, Baiersdorf (FB) |
||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||
| Abb. 05-03-05: Höhe der gemuteten Zone über der montierten Schiene: ca. 15 cm, Gleisbauarbeiten Kersbach, Baiersdorf (FB) |
||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||
| Abb. 05-03-06: Die Enden von zwei 180
m langen Schienenstücken, etwa 180 mm hoch,
spannungsfrei, Vignolschiene: https://www.gleisbau-welt.de/lexikon/infrastruktur/oberbau/schienen/schienenprofil/ Dichte 7,86 kg/dm³ Ausdehnungskoeffizient alpha 12*10-6 /K Elastizitätsmodul E 210 GPa = 210*109 N/m²
Bei einer Temperaturdifferenz ( Nacht / Tag ) von dT = 10° und einer Länge von L = 180 m ändert sich die Länge L der Schiene um dL = alpha * dT* L = 12*10-6 /K * 10 K * 180 m= 0,0216 m, das sind 2,16 cm. Läßt man das Material sich nicht ausdehnen, d.h. die Länge der Schiene bleibt fest, dann entsteht eine Zugspannung sigma (A Querschnitt) epsilon = dL/L
relative Dehnung
epsilon = alpha * dT sigma = E * epsilon sigma = E * alpha * dT
sigma = 210*109 N/m² *
12*10-6 / K * 10 K = 25.7
106 N/m²=
25.70 N/mm²
Die zugehörige Kraft F = sigma * A = 25.7 106 N/m² * 0.8*10-2 m² =20,2 104 = 202 000 N 25.70 N/mm² * 8000 mm² = 202 000 N (Zugfestigkeit von Baustahl 370 N/mm², Schienenstahl hat bessere Eigenschaften. somit folgt, daß die Zugfestigkeit durch die Temperaturspannungen nicht erreicht wird.) Wenn die Lufttemperatur beim Schweißen 10° war, gibt es bei extremen Wetterbedingungen z.B. von -20° oder +40° eine Differenztemperatur von -30° bzw. +30° . Die entsprechenden Zugkräfte bzw. Drücke wären dann 3 * 202 000 N = 606 000 N (FB) |
||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||
| Abb. 05-03-07: Schienen unter
Zugspannung, Höhe der spürbaren Zone: etwa 2 x
Schienenhöhe Creation Date (iptc): 2011-11-04T14:06:10 Bahnhof Göttingen, Gleis 9 F, Schrauben der Schwellen sind lose,(FB) |
||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||
| Abb. 05-03-08: Stempel vom
Walzvorgang, Thyssen, 88, UIC 60, Höhe 172 mm Creation Date (iptc): 2012-05-16T16:06:01 Schwellenschrauben sind lose, Göttinger Bahnhof, Gleis 9 Nord (FB) |
||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||
| Abb. 05-03-09: Schienen ohne
Zugspannung, Abstellgleise Bahnhof Goslar Höhe der spürbaren Zonen: etwa halbe Schienenhöhe (FB) |
||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||
| Abb. 05-03-10: Schienen ohne
Zugspannung, Höhe der spürbaren Zonen weniger als
halbe Schienenhöhe. Treibachsen einer Vierzylinder Dampflokomotive, Bahnhof Bad Harzburg (FB) |
||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||
| Abb. 05-03-11: Schienen völlig ohne
Zugspannung, Höhe der spürbaren Zonen: wenige
Zentimeter. Bahnhof, Braunschweig Schapen, Bio-institut (FB) |
||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||
| Abb. 05-03-12: Bahnhof Igensdorf, ca.
5°, Höhe der spürbaren Zone weniger als zweimal
Schienenhöhe (FB) |
||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||
Abb. 05-03-13: vermutlich 15°
bis 20 °, Höhe der spürbaren Zone weniger als
zweimal Schienenhöhe (FB)aus strom-netze.htm#kapitel-06-05 |
||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||
Abb. 05-03-14: Kirchehrenbach,
vermutlich 15°, Höhe der Zone: weniger als
Schienenhöhe (FB)aus strom-netze.htm#kapitel-06-05 |
5.4 Ideale Gase
 |
| Abb. 05-04-01: bei einem idealen
Gas und konstantem Druck nimmt das
Volumen mit der Temperatur linear zu (FB) |
 |
| Abb. 05-04-02: bei einem idealen Gas und konstantem Volumen nimmt der Druck mit der Temperatur linear zu (FB) |
5.5 Strömung durch Bewegung
 |
| Abb. 05-05-01: Das SW-Foto zeigt
einen Blick in das Schaufenster einer Apotheke. Dort
fährt eine kleine elektrische Eisenbahn im Kreis
herum. Beobachtung: die Bewegung ist auch außerhalb des Schaufensters zu spüren. Nachbau mit einem an einer Kurbel umlaufenden Messingstück. Es gibt feinstoffliche Strukturen, die das Entgegenkommen, Vorbeifahren und Entfernen von außen wahrnehmbar machen . (FB) |
5.6 Strömung bei einem Laserstrahl
gehört eigentlich zu seums-drei.htm
Laserstrahl durch Kunststoff-Rohr physik-neu-012.htm#12-1-03
 |
| Abb. 05-06-01: Ein Laserpointer ist
auf einer Verstelleinrichtung. Die Richtung des
Strahls läßt sich damit im Bereich von 1/100 mm fein
justieren. Beobachtung: Bei Überschreiten der Ausrichtung in jede der vier Haupthimmelsrichtungen ändert sich die Qualität der spürbaren Strukturen um dem Strahl herum. Bei exakter Ausrichtung ist sie sehr schwach, links davon Qualität 1 (z.B. CW), rechts davon Qualität 2 (z.B. CCW) Damit läßt sich auch ohne Kompass eine Himmelsrichtung bestimmen. (FB) |
 |
| Abb. 05-06-02: Der Laserpointer steht
über dem Mittelpunkt vom Meßkreis. In Blickrichtung
geht es nach Norden. Einige der von früheren Experimenten angebrachte Markierungen der geografischen Nord- und Westrichtung seums.htm sind noch vorhanden. Mit Hilfe der Feinjustierung wurde der Strahl jeweils so eingestellt, daß gerade der Qualitätswechsel eintrat. Bei mehreren Versuchen zeigte es sich, daß der rote Laserpunkt hinten an der Hecke Abweichungen von unter einem Meter / 15 Meter Entfernung (~ 4°) zu den Markierungen der geografischen Nordrichtungen hatte. Entsprechende Abweichungen gab es auch in der Westrichtung. Noch Forschungsbedarf! (FB) |
 |
| Abb. 05-06-03: Lenkt man den
Laserstrahl durch einen geschlossenen Ring (Holz,
Gummi, Kupferdraht), dann entsteht dort eine
Wirbelstruktur => es handelt sich somit um
eine Strömung. (FB) |
Literatur: b-literatur.htm
 |
www.biosensor-physik.de | (c)
07.01.2021 - 14.02.2025 F.Balck |
© BioSensor-Physik 2025 · Impressum